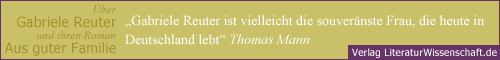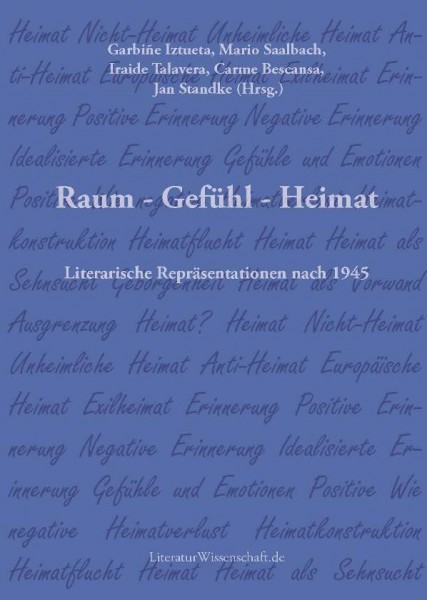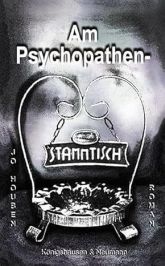Hand in Hand
Rebekka Endlers Buch bietet zwar zahlreiche Einblicke in „Das Patriarchat der Dinge“, ist aber dennoch nicht uneingeschränkt zu empfehlen
Von Rolf Löchel
„Der Mann ist das Maß aller Dinge“, wandelt Rebekka Endler die bekannte Sentenz eines antiken Philosophen der sophistischen Schule namens Protagoras ab. Damit hat sie zwar eigentlich schon alles gesagt, aber doch noch lange nicht genug. Darum hat sich die „weiße[.], hetero, ablebodied cis Frau“ auf eine „Recherchereise quer durch die tief verwurzelten patriarchalischen Ideen, die unsere Gesellschaft prägen“, begeben und ein „anti-patriarchales, antikapitalistisches Buch“ mit Beispielen des am (Durchschnitts-)Mann orientierten Designs gefüllt, die ihre kritische Behauptung vielfach belegen. Denn die patriarchale Durchdringung der Welt fängt bei der Sprache an und hört in der Arbeitswelt noch lange nicht auf.
Sowohl antipatriarchal wie auch antikapitalistisch ist Endlers Buch, weil „sich das Patriarchat und der Kapitalismus die Hand im gegenseitigen Einvernehmen über ihr Ziel, nämlich die männliche Gewinnmaximierung, [reichen]“. Wobei allerdings nicht vergessen werden sollte, dass das Patriarchat schon mehr als 10.000 Jahre auf dem Buckel hat, der Kapitalismus hingegen erst das eine oder andere Jahrhundert.
Was nun die Sprache betrifft, ist sie zwar nach wie vor patriarchal geprägt, doch immerhin ist das generische Maskulinum schon länger „nicht mehr das, was es einmal war“, wie Luise F. Pusch zu sagen pflegt. Denn gerade in geschlechtlicher Hinsicht ist die Sprache spätestens seit dem feministischen Binnen-I im Fluss, der sich mit den queerpolitischen und transaktivistischen Zeichen linguistischer Gender-Gap, Gender-Asterisk und dem (auch feministisch lesbaren) Binnen-Doppelpunkt in jüngster Zeit zu einem reißenden Strom entwickelt.
Einen Vorschlag, die Sprache nicht zu gendern, sondern sie vielmehr ganz im Gegenteil zu entgendern hat allerdings nicht erst die von Endler erwähnte Nele Pollascheck mit ihrem Plädoyer für eine „Sprachentwicklung jenseits des Genderns“ unterbreitet. Luise F. Pusch unternahm schon 1980 erste Schritte in diese Richtung, indem sie in einem Beitrag für die Fachzeitschrift Linguistische Berichte anregte, die Endung -in abzuschaffen und das Neutrum zu benutzen, wann immer das Geschlecht unbekannt ist oder es um etwas geht, bei dem das Geschlecht keine Rolle spielt. Und der – zweifellos in mancher Hinsicht kritikwürdige – österreichische Aktionskünstler und Schriftsteller Hermes Phettberg entgendert schon seit gut dreißig Jahren auf seine ganz eigene Weise.
Rebekka Endler selbst gendert mit dem Binnen-Doppelpunkt, benutzt gerne und häufig das kaum geläufige Interpunktionszeichen Interrobang (‽) und schreibt ansonsten in einem oft launigen Stil, wobei sie ohne auch nur im Geringsten ichbezogen zu sein immer wieder von eigenen Erlebnissen und Erfahrungen oder von Begegnungen mit Frauen erzählt, mit denen sie für ihr Buch gesprochen hat. Gelegentlich kommen ihre Formulierungen etwas unernst daher, was den Anschein erwecken könnte, als seien ihre Argumente nicht seriös. Ein Schein, der trügen würde. Auch wenn ihr schon einmal ein sprachlicher Missgriff unterläuft und sie von „Titten-Tam-Tam“ spricht. Außerdem grätschen ihr gelegentlich Gender-Metaphysik und Queer-Ideologie in die Argumentation. Dann hat etwa ein „weibliche[r] Fuß“ eine „cis weibliche Ferse“.
Im Zentrum von Endlers Interesse steht das an Männern orientierte „patriarchale Design“. Es findet sich auf der Raumstation ISS ebenso wie in Videospielen, der Ausrüstung von Sportlerinnen oder in der Medizin und schlägt sich selbst in der Größe von Ziegelsteinen nieder. Mit dem Design einzelner Produkte wie etwa von Fahrradsätteln oder Fußballschuhen befasst sich die Autorin sehr ausführlich und argumentiert dabei überzeugend mit anatomischen Unterschieden zwischen den Geschlechtern. Die spielen auch bei der Möglichkeit eine Rolle, im öffentlichen Raum Gelegenheit zum Urinieren zu finden. Dass es Männer hier weit leichter haben sich zu erleichtern, ist weithin bekannt. Nicht so aber, dass schon vor einiger Zeit Urinale erfunden wurden, die Männer wie Frauen benutzen können, und Bettina Möllring sogar ein Femurinal entwickelt hat, das ganz auf die weibliche Anatomie zugeschnitten ist.
Noch gravierender ist die Bedeutung biologischer Unterschiede zwischen den Geschlechtern im Bereich der Medizin. Nun nehmen ÄrztInnen und ForscherInnen natürlich nicht wirklich an, „dass Frauen und Kinder schlicht kleinere, leichtere Männer sind“. Medizinische Forschungen und Therapien handeln aber meist so, und zwar für Patientinnen nicht selten mit fatalen, gelegentlich sogar tödlichen Folgen. Doch nicht nur sie leiden unter dem allgegenwärtigen männlichen Design im Bereich der Medizin. So sind zwar „75 Prozent des Personals im Pflege- und Gesundheitssektor […] weiblich, dennoch sind die Utensilien, Klamotten und Schutzvorrichtungen für einen männlich normierten Körper designt worden“. Als hochaktuelles Beispiel erwähnt Endler, dass FFP2-Masken auf Größe und Form eines durchschnittlichen Männerkopfes zugeschnitten sind.
Immerhin wird mit dem „Aufkommen der Gendermedizin“ seit einiger Zeit die ausschließliche Orientierung am männlichen Körper ganz langsam ein wenig zurückgedrängt. Um Frauenleben zu retten, wäre allerdings eine weit schnellere Veränderung angesagt. Und nicht nur die Medizin kann für Frauen lebensgefährlich sei, sondern nicht weniger, dass Crashtest-Dummys nach den Maßen eines Durchschnittsmannes konstruiert sind. All das und sehr viel mehr ist von Endler zu erfahren.
Dennoch betont die Autorin, dass die 300 Seiten ihres Buches „kein umfassendes Inventar oder gar eine Enzyklopädie des patriarchalischen Designs“ bieten. Kein Wunder, denn das wäre vermutlich nicht einmal auf 300.000 Seiten möglich. Dabei beschränkt sich die Autorin nicht einmal auf das Design der im Titel ihres Buches erwähnten Dinge. Denn ihr Design-Begriff ist weit umfassender und beinhaltet Jesu- und Marien-Darstellungen aus verschiedenen Epochen der Kunstgeschichte ebenso wie das „Prinzip der Jungfräulichkeit“, das „im Grunde genommen ein fleischgewordenes patriarchales Design“ sei. Oder sie geht der Frage nach, ob das „Christentum per se ein männliches Design“ hat.
Gelegentlich scheint sie sogar ganz von ihrem eigentlichen Thema abzukommen. So etwa, wenn sie sich mit der Pinkifizierung des Gender-Marketings, dem misogynen Zensurverhalten von Facebook, der sexistischen Diskriminierung durch Algorithmen, dem „male gaze“ und dem „Konzept Muse“ befasst, weitschweifig die Auseinandersetzung zwischen Sigrid Löffler und Marcel Reich-Ranicki im Literarischen Quartett erörtert oder auf die Aneignung wissenschaftlicher Erkenntnisse hinweist, die zwar Frauen errangen, für die jedoch Männer den Nobelpreis einheimsten. Natürlich ist all das ebenso interessant wie wichtig, auch wenn es sich nicht im engeren Sinne um ein Design von Dingen handelt.
Scheint die Autorin ihr Untersuchungsfeld einerseits etwas zu überdehnen, so fällt andererseits ein gewisser Tunnelblick ins Auge, der sich ausschließlich auf das „weiße[.] heteronormative[.] Patriarchat“ richtet. So werden zwar Reifrock und Korsett des ausgehenden 19. Jahrhunderts thematisiert, nicht aber die engbandagierten und daher verkrüppelten Füße der Chinesinnen dieser Epoche. ‚Schönheits‘operationen kommen vor, nicht aber Genitalverstümmelungen. Auch nicht die Abtreibung weiblicher Föten in China und Indien oder dass Frauen in einigen islamisch geprägten Staaten nur in Begleitung von Männern in die Öffentlichkeit dürfen und überhaupt ihr Leben lang männliche Vormünder haben. Ebenso wenig, dass eine Frau in Zentralafrika Gefahr läuft, auf offener Straße von einer Männerhorde gelyncht zu werden, wenn ein Mann sie lauthals beschuldigt, sie habe ihm gerade den Penis kleingehext.
Ebenso auffällig ist eine Leerstelle aus dem Kernbereich des Patriarchats: die Prostitution. Weder wird das Design von Laufhäusern und Verrichtungsboxen thematisiert, noch wird erwähnt, dass Prostituierte – nicht nur in Amsterdam – im Schaufenster feilgeboten werden.
Im letzten Abschnitt wendet sich Endler Differenzmerkmalen jenseits von Mann und Frau zu. Denn, so ihr Argument, „neben der geschlechtlichen Identität [spielen] ebenso Hautfarbe (und die damit verbunden körperlichen Merkmale), sexuelle Orientierung und nicht zuletzt Ableismus eine Rolle, wenn es um die Verteilung von Macht geht“. Darum erklärt sie, dass sie „an einen Intersektionalen Feminismus glaub[t]“. Denn es gelte, „die Beziehungen zwischen den verschiedenen Mechanismen der Machtzentrierung zu untersuchen, indem ein besonderer Fokus auf Menschen gelegt wird, die sich an den Schnittstellen gleich mehrerer Diskriminierungserfahrungen befinden, zum Beispiel Sexismus, Armut und Hautfarbe“. Dass allerdings ist noch kein Feminismus, auch kein intersektionaler, sondern schlicht Intersektionalismus. Zumal, wenn – wie dies nur allzu oft geschieht und auch bei Endler anklingt – die Diskriminierungserfahrungen einfach addiert werden, statt das in verschiedenen Gesellschaften unterschiedliche Zusammenwirken von Diskriminierungen (die ja nicht unbedingt von den Diskriminierten als solche erfahren werden müssen) tatsächlich zu untersuchen.
Feministische Theorie hingegen analysiert die Interaktionen der diversen Unterdrückungsmechanismen und -formen nicht nur, sondern kommt dabei zu der Erkenntnis, dass sich in ihrem Zusammenwirken die Unterdrückung des weiblichen Geschlechts durch das männliche als die grundlegende Herrschaftsform erweist. Und dies nicht nur, weil von ihr mehr als die weibliche Hälfte der Menschheit in aller Herren Länder quer durch die letzten zwölftausend Jahre betroffen ist – und das Patriachat nicht, wie Endler meint, erst seit einigen „Jahrhunderten“ existiert.
Am bedenklichsten aber ist, dass Endler sich auf den letzten Seiten ihres Buches gegen „rückwärtsgewandte Menschen“ wendet, die ihr „besonders suspekt“ sind, nämlich gegen die „sogenannten TERFs“, also „Feministinnen, die unter dem Vorwand der Angst, dass ‚Weiblichkeit‘ als Begriff ‚schwammig‘ werden könnte, die Rechte von Transmenschen nicht anerkennen“. Gemeint sind damit Radikalfeministinnen wie die Störenfriedas und wohl auch Menschen, die einen genderkritischen Feminismus vertreten wie er unter anderem von der Philosophin Holly Lawford-Smith entwickelt wird. Welche wahren Motive der oben genannte „Vorwand“ verdecken soll und welche „Rechte von Transmenschen“ diese Feministinnen nicht anerkennen, sagt Endler nicht. Bei letzterem geht vor allem um das Recht, sich in geschützten Frauenräumen aufhalten zu dürfen.
Weiter behauptet Endler, die von ihr genderkritischen FeministInnen unterstellte „Transfeindlichkeit“ sei „eine anschlussfähige Haltung, die politische Allianzen zwischen rechten und rechtsextremen Parteien und einflussreichen Organisationen von TERFs hervorbringt“. Auch hier verschweigt sie, welchen Organisationen sie das konkret vorwirft. Vermutlich, weil es solche Allianzen gar nicht gibt. Sollte sie aber insgeheim an Terre des Femmes denken, die größte und bedeutendste Frauenrechtsorganisation Deutschlands, so zeigt schon deren Positionspapier zu Transgender, Selbstbestimmung und Geschlecht, wie abwegig derlei Vorwürfe sind.
Zum Schluss aber etwas Positives: Wie aus Endlers Buch zu erfahren ist, gibt es in Hamburg einen „Garten der Frauen“. Es handelt sich um einen auf Initiative der Historikerin Rita Bake eingerichteten „Bereich des Ohlsdorfer Friedhofs“ in Hamburg. „[E]ine Art frei zugängliches feministisches Freilichtmuseum“, in dem verstorbene Frauen eine ehrenvolle letzte Ruhe finden, „ein begehbares ‚Was wäre, wenn‘, nicht in ferner Zukunft, sondern in der Vergangenheit“. Wer immer sich in der Hanse-Stadt aufhält, sollte nicht versäumen, ihm einen Besuch abzustatten. Und auch zu Rebekkas Endlers Buch zu greifen ist – ungeachtet der angesprochenen Kritikpunkte – nicht verkehrt.
|
||