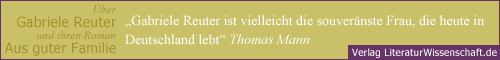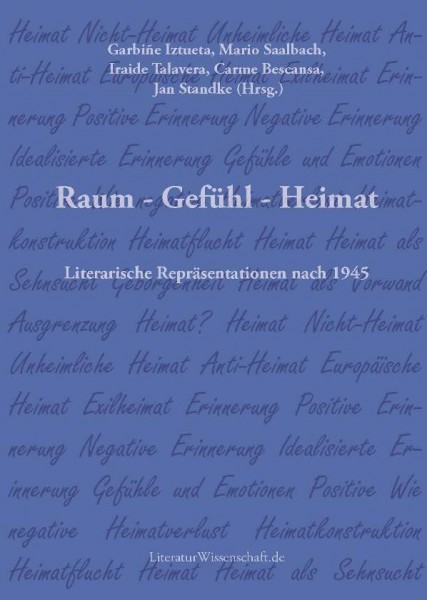„Sie waren in der Welt ein Häuflein…“
Volker Brauns neue Erzählung „Die hellen Haufen“ konfrontiert das Wirkliche mit dem Möglichen
Von Dietmar Jacobsen
Zur Geschichte gehört auch das, was nicht geschah, obwohl es hätte geschehen können – vertane Chancen, ausgelassene Möglichkeiten, ungenutzte Potenzen. Mit Volker Braun zu reden: „… auch das Nichtgeschehene, Unterbliebene, Verlorene liegt in dem schwarzen Berg.“ In seiner neuen Erzählung „Die hellen Haufen“ widmet sich der Autor diesem Denkbaren, das unterblieb. Konstruiert wird die Geschichte eines Aufstands, der nicht stattgefunden hat. Brauns fiktive Arbeiter wagen, was in der Realität der ersten Jahre nach der Wende unterblieb.
Bevor der Dichter freilich „über den Rand“ der Geschichte hinausschreibt, rekapituliert er – auf jene leicht verfremdende Weise, die man bei dem Brechtschüler Braun häufig findet – noch einmal die Fakten. Da erinnert das erste Kapitel an das vergebliche Aufbegehren der Kalibergarbeiter aus dem thüringischen Bischofferode gegen die Schließung ihres Werks im Jahr 1993. Bitterode heißt der Ort im Text und wahrlich bitter ist es, wie machtlos Brauns Arbeiter unterm Strich gegen Wirtschaft und Politik sind. Da ertrotzt man sich per Werksbesetzung und Hungerstreik zwar vollmundige Versprechen und für ein paar Wochen die Aufmerksamkeit der überregionalen Medien. Doch dem Marsch zur Treuhandanstalt nach Berlin schließen sich nicht die erhofften Massen an, so dass er einem Narrenzug nicht unähnlich erscheint: „… eine Karnevalsrotte, man applaudierte diesen Artisten, aber keiner kam mit“.
Nur auf den ersten Blick besser ergeht es jenen Mansfelder Kumpeln, von denen Kapitel 2 erzählt. Hier bleibt ein Teil der Belegschaft zwar noch für eine Weile in Lohn und Brot, aber der Zweck des Tuns, das ihnen abverlangt wird, besteht darin, die Reste jener Arbeit aufzuräumen und abzureißen, von der Generationen vor ihnen gelebt haben. Als „Zuhälter der Zukunft“ liquidieren sie ihre eigene Vergangenheit. Volker Braun schließt hier eng an seine letzten beiden Texte an – „Machwerk oder Das Schichtbuch des Flick von Lauchhammer“ (Suhrkamp 2008) und „Flickwerk“ (Suhrkamp 2009) –, die in der Tradition des deutschen Volksbuchs episodenhaft über die Narreteien der neuen Arbeitswelt berichteten. „Bekümmernis“, lässt der Dichter an einer Stelle von „Machwerk“ verlauten, sei einer der Schreibanlässe für seinen Roman gewesen. Dieses Gefühl der Trauer über das Verschwinden althergebrachter Sicherheiten wird in „Die hellen Haufen“ noch ausgeweitet. So muss der Reviersteiger Henning untertage die Schächte verfüllen, während ihm oben, im Licht, seine Frau Hanna davonläuft und Verhandlungen über eine Zukunft geführt werden, an der er nicht mehr teilhaben wird.
Den Übergang zum dritten und letzten Kapitel, mit dem die Erzählung den Boden der Realität verlässt, bildet der Bericht über eine aus dem Ruder laufende Volksbelustigung. Beim so genannten Dreckschweinfest in Hergisdorf – von Braun verfremdet zu Heringsdorf –, einem mansfeldischen Pfingstbrauch, bei dem es um die Austreibung des Winters geht, eskaliert die aufgeladene Stimmung. Aus einem uralten Ritual mit fest verteilten Rollen, bei dem sich die in einer Schlammkuhle wälzenden Vertreter des Winters von peitschenbewehrten Burschen, die als die Boten der hellen Jahreszeit auftreten, zur Freude der zahlreichen Zuschauer vertreiben lassen, entsteht eine Revolte. Diesmal nämlich wollen die Dreckbespritzten nicht mehr so einfach weichen, „als gäbe es da im Drecke was, ein elementares Recht, ein Mutterboden und Lebensgrund, von dem sie nicht lassen konnten.“ Statt des traditionellen Kampfes zweier Jahreszeiten sieht es plötzlich nach einem ganz anderen Streit aus, nämlich dem „zwischen dem armen, grauen, lausigen Säkel und der neuen hellen geleckten Zeit.“ Und plötzlich schlagen alle drein, ohne dass die schnell entfachte Wut freilich mehr wäre als in unkoordiniertem Aktionismus kulminierende Ohnmacht.
Das Gegenteil zu diesem spontan ausbrechenden Zorn der Massen, der ebenso schnell von der Staatsmacht beendet wird, wie er beginnt, erfindet Brauns Erzählung dann in ihrer zweiten Hälfte. Durchsetzt mit historischen Assoziationen – an die Bauernkriege des frühen 16. Jahrhunderts wird ebenso erinnert wie an den Mitteldeutschen Aufstand im März 1921 und dessen zentrale Figur Max Hoelz – lässt der Text die beiden Ereignisse, die in den Kapiteln 1 und 2 folgenlos blieben, jetzt eskalieren. Tote beim Hungerstreik in Bischofferode und bei den Eislebener Pfingstprotesten bringen das Fass zum Überlaufen. Im Nu sind es Hunderttausend, die es nicht mehr hält und die beginnen sich zu wehren: „Wenn man schon auf der Straße lag, wollte man sich dort zeigen“.
„Die hellen Haufen“ schließt mit der blutigen Niederlage der aufständischen Arbeiter. Auf einer Abraumhalde – wo auch sonst, schließlich empfinden sich Volker Brauns Protagonisten selbst als den Abraum der jüngsten Geschichte – findet die Utopie ihr Ende. Vorher hat man in einer kathedralengroßen Höhle noch die „Mansfelder Artikel von den gleichen Rechten aller“ beschlossen und auf die Kraft der alten Parole „Keine Gewalt!“ gesetzt. Doch selbst „einer aus dem Vogtland, Braun“, der auf der vorletzten Seite auftaucht und „im Jähzorn GEWALT, GEWALT“ schreit, weiß nicht genau zu sagen, ob er mit diesem Ruf Gewalt nur konstatieren oder sie als probates Mittel ausrufen will.
Brauns kleine Erzählung ist ein sperriger, außerordentlich welthaltiger Text. Seinem Adressaten fordert er einiges an Zeitkenntnis und Belesenheit ab. Da sind die leicht verfremdeten Personennamen wie Frau Pleuel und Herr Rohwetter von der Treuhand, Frau Süßmund aus der Politik sowie der Pfarrer Schurlemann und die Ostikone Hilde Brand. Bei anderen fällt die Tarnung weg, etwa bei der Hommage an den Ostberliner Philosophen und Ästhetiker Wolfgang Heise – Braun zählt ihn zu den „Vordenker(n)…, die nie zum Zuge kamen, weil sie nachdachten, die pluralen Marxisten und Theoretiker der Praxis, die mit Hammer und Sichel philosophierten.“ Obwohl bereits 1987 verstorben, darf er in „Die hellen Haufen“ noch einmal im Kreis jener Theoretiker Platz nehmen, die die dringenden Probleme der Nachwendezeit diskutieren und in gewisser Weise den zwölf „Mansfelder Artikeln“ das theoretische Rückgrat liefern.
Aber auch an sein eigenes, inzwischen berühmtes Wendegedicht „Das Eigentum“ erinnert der Dichter, wenn er jetzt auf dessen klassisches Pendant – Goethes 1815 erschienenen Sechszeiler „Eigentum“ – rekurriert. Was dabei zunächst etwas biedermeierlich anmuten mag in seinem Rückzug auf die Welt der Gedanken; ist es nur ein Zufall, dass ein westdeutscher Lehrer Goethes Text bei Braun deklamieren darf? –, wird, misst man es an den elegischen Zeilen von 1990, geradezu zu einer Utopie, die nach dem Ende des Arbeiter- und Bauernstaats immer noch uneingelöst ist. Brauns „Ich“ nämlich ist in jeder Beziehung eigentumslos. Die Wiedereroberung der Welt des Denkens wäre der erste Schritt hin zu einer Emanzipation, die in „Das Eigentum“ in der Gedichtzeile gipfelt: „Wann sag ich wieder mein und meine alle.“
Volker Braun hat in „Die hellen Haufen“ sämtliche Kardinalfragen, die er an unsere Zeit hat, noch einmal angesprochen. Auf knappstem Raum und unter Zuhilfenahme dichterischer Lizenzen, die es erlauben, das als ungenügend empfundene Wirkliche mit dem in ihm verborgenen Möglichen zu konfrontieren, hat er mit der Geschichte gespielt und eine Alternative konstruiert. Am Ende scheint sein Erzähler allerdings weder mit der Realität noch mit der Fiktion so richtig warmzuwerden: „Die Geschichte hat sich nicht ereignet. Sie ist nur, sehr verkürzt und unbeschönigt, aufgeschrieben. Es war hart zu denken, daß sie erfunden ist; nur etwas wäre ebenso schlimm gewesen: wenn sie stattgefunden hätte.“
|
||