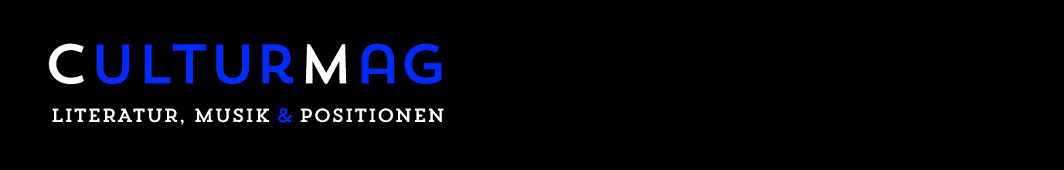Preisträger Meyer
Preisträger Meyer
Der Preis der Leipziger Buchmesse geht in diesem Jahr an Clemens Meyer für seinen Kurzgeschichten-Band Die Nacht, die Lichter. Ein (Live-)Porträt des Autors von Gisela Trahms.
Sven Regener war seit Tagen ausverkauft, bei Clemens Meyer gabs Platz. Aber die lit.COLOGNE ist natürlich Westen. Bei der Leipziger Buchmesse läufts wahrscheinlich umgekehrt. Und würde Ijoma Mangold von der Süddeutschen Zeitung etwa anreisen, um Herrn Lehmann zu präsentieren? Er kommt und plaudert lieber mit Clemens Meyer, denn der ist neu. Ein shooting star. Und aus jenem Ossi-Land, das im Westen unbekannt.
Darauf will sich der Autor von „Als wir träumten“ allerdings nicht festnageln lassen, verständlicherweise. Er war zwölf, als die Mauer fiel. Die Geschichten, die in „Die Nacht, die Lichter“ versammelt sind, könnten auch in Gelsenkirchen spielen, meint er. Sie spielen unten (auch diese Festlegung gefällt ihm nicht), aber unten ist überall und zahlreich sind seine Bewohner. Clemens Meyer, das wissen wir inzwischen aus jedem Artikel, jeder Rezension, kennt sich unten aus und hat dort gelebt, richtig gelebt, nicht bloß so recherchemäßig reingerochen. Ein tätowierter Autor mit einer Vergangenheit als Möbelpacker! Das ist ja noch exotischer als Michel Houellebecq mit seiner Plastiktüte. Ijoma Mangold spricht Lobendes. Clemens Meyer hört zu. Sie sind ungefähr gleich jung und Lichtjahre voneinander entfernt.
Als Clemens Meyer zu sprechen beginnt, ist sofort klar, dass er das Heft in der Hand behalten wird. Der Kritiker sitzt ab jetzt in der zweiten Reihe und darf Stichworte geben. Wer will schon Nachdenklichkeit, Bildung, Intelligenz, Abwägen, wenn da ein wacher, schlagfertiger, wendiger Typ sitzt, dem die Worte nur so aus dem Mund sprudeln (mit mild-erheiterndem Leipziger Anklang)? Der Fragen unterläuft, nur rauslässt, was er will, und das pointensicher? Auch auf dem literarischen Podest führt Meyer vor, wie man in dieser Gesellschaft überlebt, nämlich indem man den anderen einseift und sich selbst alle Wasser vorbehält, mit denen man gewaschen ist. Schlagartig bringt er das Publikum auf seine Seite, indem er den Schlicht-Naiven gibt: Erzähltheorie? Och nö… All diese Fremdwörter, dieses aufgemotzte Intellektuellengetue… Nützt doch nichts, der Text muss gut sein, darauf kommt es an… Aus dem Bauch heraus muss sie kommen, die Literatur, authentisch sein, aber natürlich genügt das nicht; der Aufbau, die Schnitte, die Sprache, das muss stimmen, betont er, und danach möchte ich bitte auch beurteilt werden, ich bin ja kein schreibender Knacki, sondern Autor. Charmantes Lächeln, kokette Blicke: Ich mach das hier nicht zum ersten Mal. Aber der Spaß daran ist noch echt.
Gelesen hat er immer, von Kind an, geschrieben auch, schon lange, und das Studium am Leipziger Literatur – Institut, das er durchlief und abschloss, war wohl nur eine Warteschleife, um sich selbst mal auf andere Weise auszutesten als bei den Möbelpackern. Sein Auftritt zeigt, dass er den Test bestanden hat.
Und nun liest der Autor eine der neuen Geschichten, sie heißt „Die Flinte, die Laterne und Marilyn Monroe“. Er liest brillant. Auch hier hat er die Zuhörer im Griff, Autor und Publikum lachen gemeinsam, alle auf einer großen Welle der Sympathie. Die Erzählung beginnt mit der Beschreibung der Flinte, und gleich merkt man: Der Autor kennt sich aus, er benutzt das richtige Vokabular und überführt die Realität ohne Reibungsverlust in den Text. Dann bringt der Ich-Erzähler seine Liebste ins Spiel, die im Nebenzimmer auf dem Bett liegt und nicht kommt, als er sie ruft. Jeder Leseerfahrene weiß augenblicklich: die ist tot. Dass der Erzähler es nicht sofort weiß, vollgedröhnt, wie er ist, mag angehen. Aber dass auch der Autor so tut, als wüsste der Leser nicht, das tötet die Geschichte. Und dass dieser „mein Schatz“ nun auch noch Marilyn Monroe gleichen muss, killt sie (die Geschichte) noch einmal. Und die coolen Sätze, aus denen das Pathos suppt, das ist doch durch… Schwarze Serie, vierziger Jahre, Hemingway, Carver, Burt Lancaster in Feinripp, todgeweiht… Alles bekannt. Nun spielt es in Leipzig oder Gelsenkirchen, aber absehbar bleibt es. Machen Sie mal den Meyer-Test: Erzählen Sie einem Freund, dass Sie eine Geschichte gelesen haben über zwei Knackis, einer jung, einer alt, und der alte redet immer von seiner Tochter, die eine Ausbildung macht im Hotel, und dann findet der junge raus: die arbeitet gar nicht im Hotel, die ist… Genau. Erraten.
Nun muss uns eine Geschichte ja nicht überraschen. Wir folgen auch gern, wenn wir wissen, wo’s langgeht. Aber diese Geschichten sind auf Überraschung hin konstruiert. Auf „Hier-stimmt-jeder–Satz-und-am-Schluss-knallts“. Das bedeutet: Risiko. Wenn Meyer das liest, zieht er den Zuhörer mit. Zuhause, auf dem Sofa, allein mit dem Buch, funktioniert das Muster nicht, und schon gar nicht ein Dutzend Mal hintereinander.
Den „Preis der Leipziger Buchmesse“ hat er nun trotzdem gekriegt. In Köln auf seine Nominierung dafür angesprochen, sagte er: Ja, natürlich wolle er den Preis, klar würd er sich freuen, wenn. Aber eigentlich hätte er ihn 2006 kriegen sollen, für den Roman. Das klang fast ein bisschen wehmütig, so als habe der Erfolg die Möglichkeit der ganz großen Freude schon getötet. Wenn man die Liste seiner Lesetermine anschaut, möchte man ihm Warnendes zuflüstern. Zum Beispiel: Nicht so quick, Clemens. Lass dich nicht verheizen. Eigene Wörter hast du. Aber Geschichten brauchen Zeit. Wenn es wirklich deine eigenen sein sollen.
Gisela Trahms
Foto: Jürgen Bauer