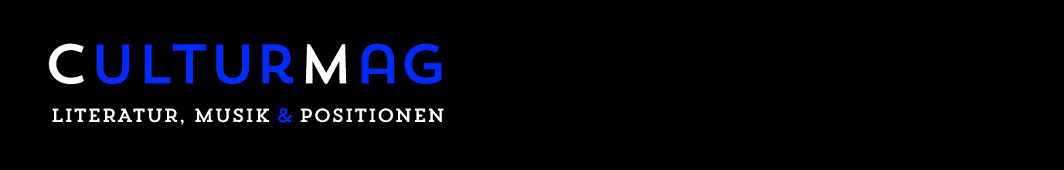(AM) Auf 450 Buchseiten kalkuliert war 2017 das Projekt »Leichenberg. Präposthumane Schriften. Herausgegeben von Claudia Denker. Mit ergänzenden Texten von Jochen Schmoldt (Chefredakteur PLÄRRER) und jan Christian Schmidt (Herausgeber kaliber.38) und Erläuterungen von Thomas Wörtche. Paperpack. Mit Glossar. 30,00 Euro« im CulturBooks Verlag. ”30 Jahre Nachdenken über Crime Fiction. Ein einmaliger Führer durch die Kriminalliteratur«, war der Teaser überschrieben.
Der „Leichenberg“ war eine der allerersten, dienstältesten Kolumnen zur Crime Fiction in Deutschland, mutmaßlich 1987 begonnen und mit langem Atem geführt. Herausgeberin Claudia Denker rekonstruierte für den geplanten Band die Anfänge und alle Kolumnen bis 2017. Der „Leichenberg“ erschien im aufmüpfigen Nürnberger Stadtmagazin PLÄRRER, aber immer mal wieder auch an anderen orten in Deutschland und Österreich. Pro monatlicher Ausgabe wurden mindestens vier, manchmal sogar bis zu zehn Kriminalromane aus den jeweiligen Neuerscheinungen kondensiert und meinungsstark auf den Punkt besprochen. Immer schon gab es auch ein Auge für Sachbücher und Graphic Novels.

Diese Kolumnen alle zusammengeführt, so die Idee für den Band, entstände ein einmaliger Führer durch die im deutschsprachigen Raum veröffentlichte Kriminalliteratur der letzten 30 Jahre. Die lange Laufzeit würde es möglich machen, heute berühmte Autoren seit ihren Anfängen zu beobachten und böte zugleich eine Fundgrube für verschollene, für obskure, für zu Unrecht vergessene und inzwischen wiederbelebte Autoren. Außerdem ergäbe sich so ein kleines Panorama der einschlägigen Verlagsgeschichte.
Das Buchprojekte realisierte sich aus Kostengründen dann leider nicht. Jan Christian Schmidt hält auf seiner Website kaliber.38 jedoch den gewaltig großen »Leichenberg« von 12/1994 bis 02/2021 digital zugänglich. Die Lektüre lohnt. Machen Sie eine Stichprobe – oder steigen Sie in die völlig subjektiv ausgewählten Beispiele hier weiter unten. Die Texte sind wegen der immer kundigen, meisterhaft komprimierten und gern auch polemischen oder witzigen Schreibart von Thomas Wörtche erstaunlich wenig gealtert, bieten immer noch reichen Erkenntnisgewinn.
Mit freundlicher Genehmigung der Autoren bringen wir hier das für das Buch geplante »Leichenberg«-Vorwort von PLÄRRER-Chefredakteur Jochen Schmoldt sowie eine Hommage von Jan Christian Schmidt. – Und im Anschluss eine klitzekleine Auswahl an Leichenberg-Texten…
** **

Kraut oder Rüben? – Vorwort von Jochen Schmoldt
Die Waffen des Kritikers sind variabel: geschossen wird mit Schrotflinte, Revolver, Pistole, Gewehr. Schalldämpfer kommen niemals zur Anwendung, denn der Kritiker will gehört werden. Ein Zielfernrohr ist selten nötig, die Ziele sind unbeweglich. Es sind Kriminalromane, die hier unter verbalen Beschuss genommen werden. der Umgang mit ihnen war jahrzehntelang pure Tristesse, denn kein einziger namhafter deutscher Kritiker hätte es vor Zeiten riskiert, sich um Kopf und Kragen zu schreiben, indem er Bücher rezensiert, die dem literarischen Niemandsland zu entstammen schienen. Man las sie nicht, und wenn doch, dann unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit. Zum Beispiel die Maigret-Romane von Georges Simenon. Und da war die nervende Invasion von Edgar Wallace-Krimis, die freilich heute wirklich kein Mensch mehr lesen mag, nicht einmal heimlich. Erst mit den Romanen des schwedischen Autorenpaares Maj Sjöwall und Per Wahlöö begann man hierzulande zu ahnen, dass Kriminalromane allen Ernstes etwas mit »Literatur« zu tun haben. Das begann in den Sechziger Jahren, und gewiss nicht in den tonangebenden Feuilletons. Dort finden sich Kriminalromane nach wie vor kaum oder gar nicht.
Zwar werden heute von vielen Verlagen bis hin zu Suhrkamp hochklassige internationale Autoren des »Genres« relativ zeitnah und oft sehr gut übersetzt, allerdings auch diffus vermarktet – konsequente Autorenpflege war einmal. Klasse-Thriller bewegen sich ungeschützt inmitten des moussierenden Minenfelds der sog. »Regionalkrimis«, die bald wirklich jeden deutschen Fachwerkbalken beschrieben haben und in der Regel eher die Sprengwirkung von Lady Crackers haben: Kraut & Rüben aus Deutschland. In all diesen Aufmarschgebieten schießt Thomas Wörtche seit nun schon Jahrzehnten seine Schreibmaschinengewehrsalven ab. Als grobes Sperrfeuer wider literarische Blendgranaten, fein ziseliert in den Fällen von echten Kalibern. Unberührt von der Gretchenfrage, ob das Objekt seiner Leidenschaften und Lesewut »Literatur« sei, schrieb und schreibt er mit enormer Trefferquote, und zwar so knapp und geschwätzfrei wie nur irgend möglich. »MordsLust«: ein Solitär in der Kritikerlandschaft der Kriminalliteratur.
Jochen Schmoldt – 1949 in Korbach geboren, Germanistik-Studium in München, seit 1980 Redakteur des Nürnberger Stadtmagazins plärrer, ab 1986 dessen leitender Redakteur. Daneben zahlreiche kulturelle, insbesondere cineastische Publikationen, Berge von Literaturrezensionen, langjährige Mitarbeit beim »Filmfestival Türkei-Deutschland«.
** **

Jan Christian Schmidt: Qualitätskontrolle
Das war eine Reise ins Wonderland 1996: Kiste hochfahren, Netscape starten, Modem zum Pfeifen bringen, und ab ging’s. Zunächst nur in die Küche, Kaffee kochen, denn bis sich über die Telefonleitungen die ersten Seiten des Internets aufgebaut hatten, vergingen einige Minuten. Im günstigen Fall. Auch war noch keine Rede von den unendlichen Weiten des World Wide Web – die Anzahl der Internetpräsenzen war so überschaubar, dass sie – vergleichbar den alten Zettelkästen in Bibliotheken – in Webkatalogen archiviert wurden.
Wir User (hießen wir damals so?) waren eine kleine Minderheit. Wer sich Mitte der 90er Jahre einen Zugang zum Internet legen ließ, hatte ein wie auch immer geartetes profundes Interesse an einem Thema. Beste Informationsquelle waren oft nicht Websites, sondern Newsgroups, in denen sich ein internationales, (meist) sachkundiges Publikum traf und leidenschaftlich diskutierte. Für mich, damals Angestellter einer Krimibuchhandlung, idealer Fundus zu allen kriminalliterarischen Themen, unerlässliche Hilfe beim Bibliographieren internationaler Autoren und, selbstverständlich, nicht versiegender Strom an Lektüre-Empfehlungen von Büchern, die in Deutschland noch unbekannt waren.
Die Übertragungsgeschwindigkeit jener Tage war von der heutigen weiter entfernt als die frühe Dampfeisenbahn vom ICE. Das Warten auf den Seitenaufbau saugte nicht nur an den Nerven, sondern auch das Geld aus dem Portemonnaie. Fläht-was? Hä?? Die Verbindung wurde pro Minute abgerechnet, Monatsrechnungen jenseits der Hundert-Mark-Grenze für aficionados üblich!
Für uns, die wir Texte verfassten und Seiten rund um die Kriminalliteratur programmierten, hieß die unerträgliche Langsamkeit des Seins: Wie lang darf ein Text sein, der an einem üblichen Schwarz-Weiß-Monitor mit 14 oder 15 Zoll Bildschirmdiagonale gelesen wird? Wie groß und schwer die Grafiken? Die Fragen beschränkten sich nicht nur auf die technische Seite, sondern gingen weiter: Darf man eine Rezension überhaupt mit einem Buch verlinken, oder wird die Glaubwürdigkeit einer Buchkritik dadurch erschüttert, dass man den Titel auf der gleichen Internetpräsenz kaufen kann? Wo ist die Grenze zwischen Kritik und Marketing, und wie macht man sie für Besucher sichtbar?
Aus der Distanz betrachtet, mit zwanzig Jahren Abstand, erscheinen diese Fragen vielleicht lächerlich. Aber bitte: Den Internet-Riesen Amazon gab es nur in den USA (und er war noch ein Zwerg), und die meisten der Ihnen heute bekannten großen Buch-Anbieter, Literaturportale und Verlagsseiten waren noch nicht online. Es gab keine Vorbilder für das, was wir taten oder zu tun beabsichtigten.
Ich möchte Sie nicht langweilen mit meiner Rückschau, nur kurz den Rahmen umreißen, in dem Thomas Wörtches „Leichenberg“ im Internet in seiner Anfangszeit erschienen ist. Der „Leichenberg“ ist keine Internet-Kolumne, aber die „Leichenberg“-Texte waren – und sind – ideal für das Internet: Vom Umfang her überschaubar, klar strukturiert (meist korrespondiert ein Absatz mit einem besprochenen Buch), aufs Wesentliche reduziert, pointiert formuliert.
Soweit ich sehe, war Thomas Wörtche der erste professionelle Krimi-Kritiker, der im Internet regelmäßig zu lesen war – in einem Umfeld, in dem viele Autoren zwar eine mit Feuereifer vorgetragene Meinung, aber nicht unbedingt profunde Kenntnis in der Sache haben. Das Publikum nahm das Angebot dankend an: Das Verzeichnis mit den Wörtche-Texten wurde bei „kaliber .38“ schnell zu einem Publikums-Magneten, die „Leichenberg“-Seite, auf der jeweils die neueste Version der Kolumne angekündigt ist, ist bis heute die Datei, die neben der Index-Seite – dem Portal zur Website – die meisten Klicks generiert.
Thomas Wörtche muss ich Ihnen nicht groß vorstellen. Geboren 1954 in Mannheim, studierte er Germanistik und Philosophie an den Universitäten Bochum und Konstanz, 1987 promovierte er über phantastische Literatur. Er schrieb Literaturkritiken für nahezu alle überregionalen Zeitungen in Deutschland und lehrte hin und wieder an Universitäten. Seit knapp vier Jahrzehnten durchpflügt er wie ein „Trüffelschwein“ (Selbstbeschreibung TW) das kriminalliterarische Unterholz und erarbeitete sich den Ruf als wichtigster und wirkmächtigster deutscher Krimi-Kritiker. Eine besondere Liebe verbindet ihn übrigens mit der Jazz-Musik – eine Zuneigung, von der auch viele seiner Krimi-Kritiken zeugen.
Das geplante Buch umfasst mehrere Tausend Buchbesprechungen von einigen Hundert Autoren aus rund zweieinhalb Jahrzehnten. Viele der rezensierten Krimis werden nicht mehr aufgelegt, manche Autoren sind ganz vom deutschsprachigen Markt verschwunden (die Damen Barnes, Grafton, Paretsky oder auch die Herren McNab, Perry, Wambaugh). Trotzdem blättere ich immer wieder gerne durch die „Leichenberge“, weil die unbestechlichen, glasklaren Betrachtungen und rasiermesserscharfen Formulierungen ein wohltuendes Gegengewicht zum aufgeregten Geschnatter der Marketingabteilungen bilden (und manchem Handlanger in den Feuilletons) – und weil das kunstvolle Wüten gegen „unbedarftes Schreiben“ (TW) einfach Spaß macht und Literaturkritik auf der Höhe seiner Zeit darstellt.
Ich möchte mich bei Thomas Wörtche bedanken: Natürlich dafür, dass ich seine Texte unter dem Dach „kaliber .38“ im Internet präsentieren darf. Aber wichtiger noch: Auch wenn ich nicht jede Wertung teile, haben seine Texte meinen Blick ganz deutlich geschärft, mir viele vergnügliche und produktive Lesestunden beschert, und mich vor manch fettiger Schwarte bewahrt. Thomas Wörtches Texte sind für mich nicht bloß Krimi-Kritik, sondern immer auch aufklärerische Zeit- und Zeitgeistkommentierung, Entschleierung verlogener Narrative und Kompass in nicht immer überschaubaren Zeiten.
Sie, liebe Leserin und lieber Leser, möchte ich mit einem Wörtche-Zitat in die Lektüre der „Leichenberge“ entlassen, das man diesem Buch als Motto voranstellen und wohl getrost als Leitfaden der Arbeit seines Verfassers sehen kann: „Der ärgste Feind von Literatur ist immer noch schlechte Literatur“.
Jan Christian Schmidt, August 2017
** **
Thomas Wörtches »Leichenberg« – einige Stichproben aus drei Jahrzehnten

Leichenberg 02/2021
Empfehlenswert spannend ist eine Neu-Lektüre von George Orwells 1984 (dt. von Jan Strümpel, Anaconda). Ob sich eine Neuübersetzung wirklich aufdrängt oder nicht, ist an der Stelle egal, wichtig ist eher, dass dieser Klassiker wieder als Kontrastmittel Aufmerksamkeit verdient hat. Dystopien sind gerade das Thema à la mode, und es ist schon interessant zu sehen, wie sie im Gegensatz zu Orwells Hammer zu literarischem Kleingeld geschrumpft sind. Der Unterschied ist deutlich: Viele der heutigen Dystopielein rechnen einfach ein paar Trends, die eh deutlich zu sehen sind, hoch: Umwelt, Klima, neu reingekommen: Pandemien (naja, so neu nun auch wieder nicht), Stromausfall, Wassernot, Überwachung, Social Scoring und so weiter (wenig Atomkrieg, gerade, nu), garniert mit ein paar Protagonisten, die mit den jeweiligen Katastrophen im Handgemenge liegen. Ausnahmen wie Max Annas‘ „Finsterwalde“ und ein paar andere bestätigen die Regel. Das generiert sicherlich die üblichen abscheulichen Rezeptionssprachspiele: „ein Buch, das zum Nachdenken anregt“ oder „erschreckend“, so als ob man zum ersten Mal von den Folgen des Klimawandels hören würde, und schafft das gute Gewissen, immer schon auf der warnenden Seite gewesen zu sein resp. zu sein.
Insofern ist es – paradoxerweise – eine Qualität, dass 1984 kein „guter Roman“ ist, wie ja auch immer wieder kritisch angemerkt wurde. Das Buch ist ein gewaltiges Gedankenexperiment, eine monströse Vision, die zwar ihre Quellen im Stalinismus und Nationalsozialismus hatte, aber viel weiter geht. Es geht um inhaltlich/ideologisch absolut leere Macht, autotelische Macht, die sich systemisch zu einer Hegemonialstruktur verfestigt hat, die keine Ziele und Zwecke mehr kennt und bei der noch nicht einmal mehr individuelle Profiteure zu identifizieren sind. Selbst die letzten Akte von Subversion (Sex, der den Namen verdient, „Widerstand“) sind integraler Teil des Systems, weil sie schon längst als solche eingepreist sind, und von den Algorithmen des Machterhalts – auch wenn Orwell diesen Terminus nicht benutzt, aber darum geht es letztendlich in dem Buch – mitberechnet werden. Ein solcher Wurf braucht keine Romanhandlung im engeren Sinn, keinen stringenten Plot, keine „Figurenzeichnung“, keine Identifikationsmöglichkeiten, keine Intrigen und Machinationen, um zu funktionieren. Kein Mensch wird jedoch bestreiten, dass 1984 funktioniert hat und immer noch funktioniert, gerade weil es die Erzählkonventionen des 19. Jahrhunderts vermeidet, deren untote Wiedergängerhaftigkeit es schafft, Dystopien heute so zu inszenieren, wie einen Kriminalroman des Golden Age, siehe oben. Weil 1984 kein „guter Roman“ ist, ist es ein gewaltiges Stück Weltliteratur. Wie gesagt, Re-Reading lohnt sich. Demnächst an dieser Stelle: „Animal Farm“.

Leichenberg 11/2020
Bodo V. Hechelhammers Spion ohne Grenzen. Heinz Felfe. Agent in sieben Geheimdiensten (Piper) rekonstruiert das Leben des Mannes, der eines der größten Desaster des Bundesnachrichtendienstes war. Tatsächlich schaffte es Felfe, für den Sicherheitsdienst (SD) der Nazis zu arbeiten, für den MI6, für den KGB, für die Organisation Gehlen, also den späteren BND, für die Vorläuferorganisation des VS und für die Stasi auch. Vom SS-Obersturmführer zum Professor für Kriminalistik an der Humboldt-Uni (bis 1991), das ist schon eine Karriere. 1961 wurde Felfe als „Leiter der Gegenspionage Sowjetunion“ im BND enttarnt und ins Gefängnis gesteckt, aber schon 1969 vom KGB ausgetauscht und lebte, bis zu seinem Tod am 8. Mai 2008 („Tag der Befreiung“, welch hübsche Ironie) in Ost-Berlin. Felfe war der absolute Anti-Glamour-Spion, ein unauffälliger, eher sauertöpfischer Spießer, geldgierig ohne Ende, nach oben buckelnd, nach unten tretend, aber wenn nötig auch dreist und fordernd, wenn’s der Vorteilnahme diente. So quälte Felfe nach seiner Umsiedlung in die DDR die Stasi bis aufs Blut mit Sonderwünschen für sein (relatives) Luxusleben, wohl wissend, dass er vom KGB gedeckt wurde. Denn für den KGB war Felfe der Propagandacoup überhaupt, schon beinahe auf dem Niveau der Cambridge Five. Felfe steht natürlich auch für die Kontinuität der Nazi-Strukturen über die „Organisation Gehlen“ bis zum BND, die Hechelhammer (im Hauptberuf Leiter des Historischen Büros des Bundesnachrichtendienstes) mit unfasslicher Materialfülle nachzeichnet, kein Ruhmesblatt für die Sicherheitsarchitektur der BRD. Aber nix für Verschwörungstheoretiker: Felfe war genauso überzeugter Nazi wie er überzeugter Kommunist war und dabei voll auf dem Boden des bundesdeutschen Grundgesetzes stand, falls erforderlich. Geltungsdrang, gnadenloser Opportunismus, bürokratische Virtuosität, moralische Indolenz und Gier, eine Kombination, mit der man vermutlich sehr weit kommen kann. Egal, wann und wo. Insofern ist Hechelhammers Felfe-Porträt auch ein beklemmendes Porträt des systemoptimierten Menschen und damit ziemlich aktuell. – Anm. d. Red.: Siehe dazu in dieser Ausgabe auch Bodo V. Hechelhammer über seine erste Begegnung mit TW.

Nur ein paar Kilometer vom Polarkreis entfernt liegt im Nordosten Islands das Dorf Raufarhöfn. Früher war die Gemeinde ein lebhafter Umschlagplatz für den Heringsfang, heute hat der Strukturwandel das Dörfchen ausgeblutet, bald wird die Schule schließen, denn nur ganze 175 Einwohner sind übriggeblieben. Am Ende von Joachim B. Schmidts Roman Kalmann (Diogenes) sind es noch 173. Kalmann Óðinsson, die titelgebende Hauptfigur, wacht über sein Dorf, ausgerüstet mit Cowboyhut, Sheriffstern und einer Mauser aus dem Koreakrieg. Als Kalmann eine Blutlache findet und der ortsansässige Hotelier und Unternehmer verschwindet, kommt Leben in die abgelegene Gegend. Die Polizei taucht auf, Drogen werden aus dem Wasser gefischt und zudem könnte ein hungriger Eisbär, von Grönland herübergeschwommen, sich gefährlich nahe an Raufarhöfn tummeln.
Der Schweizer Autor Joachim B. Schmidt, der selbst seit dreizehn Jahren auf Island lebt, präsentiert, so gesehen, das ideale Setting für einen klassischen Island-Krimi, oder neudeutsch: Nordic Noir. Bizarre Details wie eine Menschenhand im Magen eines erlegten Hais, dubiose litauische Menschen, die sich an den Rändern der Handlung tummeln sowie ein weiterer rätselhafter Todesfall, der mit dem Verzehr von Gammelhai zu tun haben könnte, verstärken diesen Eindruck noch. Aber die Geschichte wird uns von Kalmann erzählt. Der ist ein wunderlicher Mensch, böse Zungen bezeichnen ihn als den „Dorfdepp“, was entschieden nicht stimmt. Kalmann ist nicht nur ein geschickter Haifischer (und produziert den „zweitbesten Gammelhai auf Island“: gewöhnungsbedürftiges, fermentiertes Haifleisch), Jäger und Spurenleser, sondern auch ein entfernter Verwandter von John Irvings „Garp“ oder Forrest Gump, also ein extrem subjektiver Ich-Erzähler, der ganz eigene Wahrheiten und Einsichten in den Lauf der Welt anbietet. Schmidt benutzt dafür die literarische Technik des „skaz“ – also die hochliterarische Verschriftlichung anscheinend naiven mündlichen Erzählens, bei dem wir über den Wahrheitsgehalt des Erzählten nur das wissen können, was durch den Filter von Kalmanns Weltbild durchdringt. Dabei wissen wir auch nicht, was er verschweigt. Und wir wissen nicht, wie naiv Kalmann wirklich ist und können nur spekulieren, ob er leicht retardiert ist oder einfach nur ein sehr origineller Kopf.
Das berührt eine Kernfrage des Kriminalromans an sich. Denn der muss ja, um eine Realität hinter der Realität aufdecken zu können, eine stabile erste Realität etablieren. Das tun Kalmann, der Roman, und Kalmann, die Figur, gerade nicht. Zumindest nicht bis zu dem Punkt, an dem Kalmann selbst enthüllt, was es mit dem verschwundenen Hotelier auf sich hat. Auch diese Enthüllung steht dann natürlich unter dem grundsätzlichen Vorbehalt der Erzählperspektive. Das ist sehr tricky gemacht und bietet, neben grandiosen Vignetten über das Leben in einem gottvergessenen Winkel der Welt, über die raue Natur und über die Menschen, die dort ausharren, ein erhebliches intellektuelles Vergnügen. Kalmann ist ein großartiger Nicht-Kriminalroman, der, weil in der Negation das Negierte bestehen bleiben kann, dennoch ein großartiger Kriminalroman ist.

Die westliche Zivilisation, so sagt man gerne, basiert im Wesentlichen auf der Antike. Reden wir hier aber nicht von edler Einfalt und stiller Größe und auch nicht vom Hort der Demokratie oder ähnlichen ersprießlichen Dingen, sondern reden wir von abgeschnittenen Geschlechtswerkzeugen, blutgierigen Monstern, beklagenswerten Schändungen, Meuchelmorden galore, zoophilem Schweinskram, irren Vatermördern, brandschatzenden Heroen, fiesen Giftmorden, Kannibalismen, Inzest, Marter und Folter, Eifersucht und Rache. Und schon sind wir bei den Quellen unserer Zivilisation angekommen, bei ihren Mythen und Sagen, denen wir noch heute auf Schritt und Tritt begegnen – vor allem in den sich so originell dünkenden Serialkiller-Narrativen, in Slasher-Orgien und anderen Hervorbringungen der Populären Kultur. Damit niemand mehr sagen kann, das habe er/sie aber nicht gewusst und schließlich sei es eine Zumutung, die Texte von Homer, Ovid, Hesiod und Co. zu lesen („dieser Schreibstil gefällt mir nicht“), hat sich Stephen Fry die Mühe gemacht, ach wo, das Vergnügen gegönnt, diese Basis unserer Kultur nachzuerzählen: Helden. Die klassischen Sagen der Antike neu erzählt (Aufbau. Dt. von Matthias Frings). Der Kontrast zum Hohen Ton, den ich Bildungsbürger bei Gustav Schwabs „Sagen des klassischen Altertums“ (1838-1840; damit ist noch meine Generation in den 1960s aufgewachsen) so kreuzkomisch fand, könnte nicht größer sein. Fry plaudert locker, natürlich sprachlich aktualisierend und oft ironisch kommentierend (natürlich kann er sich z.B. bei der Nummer von Zeus mit Danaë – Sie wissen schon, der Goldregen – den zarten Hinweis auf eine Golden Shower nicht verkneifen), aber stets quellensicher und vor allem seinen Gegenstand ernst nehmend. Das ist wichtig, denn es geht tatsächlich um die Motivgeschichte nicht nur der Populären Kultur, sondern um die tief in die Menschheitsgeschichte eingeschriebene Gewaltkultur. „Helden“ ist übrigens der zweite Teil einer Trilogie: „Mythos“ hieß der erste Band, „Troy“ (gerade auf Englisch erschienen) wird den 3. Teil ergeben. Sollte man schon kennen…
+++

Leichenberg 02/2019
Als Rowohlt den Relaunch von Harry Binghams Fiona-Serie startete, gab es zurecht viel Lob und Applaus. Jetzt, beim vierten Buch, Fiona – Unten im Dunkeln (dt. von Kristof Kurz) ist es ein bisschen ruhiger geworden. Das ist schade, denn Binghams Production Design setzt auf Concept Art, was wahrlich nicht für jede beliebige Serie gilt. Will sagen: Die Entwicklung der Figur Fiona ist für den jeweiligen Roman konstitutiv wichtig. Detective Constable Fiona Griffiths von der Waliser Polizei leidet unter dem Cotard-Syndrom, eine Krankheit, die die Patientin glauben lässt, sie sei tot – einhergehend mit Persönlichkeitsstörungen, Wahnvorstellungen, sozialer Desorientierung, Depressionen und merkwürdig verteilter Empathie. Fiona, die sich auch blitzschnell in die Putzfrau Fiona Grey verwandeln kann, kennt ihre Probleme genau und versucht, auf dem „Planeten Normal“ zu landen, mittels sozialer Mimikry. Und sie ist ein Genie der Mustererkennung, deswegen sieht sie Zusammenhänge, die anderen Menschen verborgen bleiben. Im Fall „Unten im Dunkeln“ gibt es nur mikroskopisch kleine Hinweise, dass ein Versicherungsbetrug, ein anscheinender Selbstmord und ein anscheinender Unfall Mosaiksteinchen eines gigantischen Betrugsszenarios sind, das mit der Schnelligkeit von Datenübertragungen bei Finanzoperationen zu tun hat. Und somit mit Kabeln, die im Atlantik verlegt werden. Nach einigen Twists und Wendungen, die auch in die reichlich abgedrehte Welt von Hochrisiko-Kletterern führt, landet Fiona zunächst auf einem Folterstuhl mitten im ländlichen Wales – eine irre Situation, denn wie will man jemand foltern, der denkt, er sei schon tot? Und schließlich heuert sie, die schlechteste Köchin der Welt, als Smutje auf einem Fischtrawler an, der alles andere als fischen im Sinn hat. Diesen Wahnsinnsplot, der auch noch in andere Richtungen zielgerichtet mäandert, lässt Bingham von Fiona selbst erzählen, die sozusagen ihre eigene, selbstreflektive Metaebene mitliefert. Das ist extrem komisch (Fiona und das Soziale), radikal (Fiona und die Folter), provozierend (Fionas Obsession für Leichen) und sehr erfreulich intelligent und elegant in beste Prosa umgesetzt. Wenn wir weiter darauf bestehen wollen, dass sich Kriminalliteratur nicht der U/E-Schere ergeben soll, brauchen wir dringend Bücher mit hohem U-Wert auf höchstem Level. Binghams Fiona-Serie ist ein Paradebeispiel dafür.

Hohen Unterhaltungswert bieten die Haiti-Romane von Gary Victor. Das liegt einmal an seiner Hauptfigur, Inspecteur Dieuswalwe Azémar, der alles Mögliche ist: irre, gewalttätig, versoffen und verhurt, aufrecht und radikal, aber keine Sekunde langweilig. Das gilt auch für seine bizarren Abenteuer – das neuste heißt Im Namen des Katers (litradukt, dt. von Peter Trier), in dem es tatsächlich um einen entführten (?) Kater geht, um Katzenfleischesser, die zuhauf abgemetzelt werden, um einen garde (einen Voodoo-Schutzzauber), der in Azémar implantiert ist, der aber plötzlich ziemlich abwegige Gegenleistungen fordert, wie zum Beispiel geliebte Menschen zu köpfen. Aber natürlich geht es dann letztlich um was ganz anderes. Denn es kommen ganz handfeste Elemente hinzu, die Haiti zu so einem chaotischen und blutigen Ort machen: Verteilungskämpfe von Gangs, politische Macht und blanke Ausbeutung, Regierungskriminalität und narcotráfico. Für einen anständigen Menschen wie Azémar bedeutet das: töten, töten und töten, die einzige Diskursform, die noch einigermaßen sinnvoll zu sein scheint. Eine grausige Dialektik, deren systemischem Zwang Victor mit seinem grotesken, oft halluzinatorischen Humor begegnet, mit der Art von schwarzer Komik, die, ganz im Sinn von Jean Paul, „weltzernichtend“ sein muss, um überhaupt noch über die Welt erzählen zu können. Das ist krass, aber eben auch extrem unterhaltend.
+++

Leichenberg 11/2018
Einen hohen Wahsinnsquotient hat auch Gerd Zahners Goster (:transit). Auch Goster ist ein, milde gesagt, egozentrischer Polizist aus Berlin, ein Einzelgänger und Quertreiber. Vermutlich Eigenschaften, die man braucht, um mit dem kreischenden Wahnsinn fertig zu werden, der sich in merkwürdigen Todesfällen manifestiert: Locked Room Mysteries, die ihren Ursprung in eigenartigen Sexualpraktiken und deren viraler Verbreitung haben, und Schusswaffen, die ein doch recht autonomes Eigenleben entfalten. Spott und Hohn für alle Leute, die einen „anständig geplotteten“ Kriminalroman verlangen, als ob sowas „realistischer“ sein könnte als die Halluzinationen, die Gerd Zahner so erzählt, als ob sie „realistisch“ seien. Aber um genau diesen „Sachrealismus“ in die Tonne zu treten, stilisiert Zahner seine Prosa. Deutlich hört man die Echos von Adornos eigenwilliger Satzstellung, die Szenen sind minimalistisch, „Maximen und Reflexionen“ allüberall, aber garantiert ins Schräge gedreht, Minima Moralia aus dem Stadtalltag, das Banale wird überhöht, das Wichtige wird peripher. Und ziemlich komisch ist dieser wunderbare schmale Text auch noch.
+++

Leichenberg 10/2018
Einen wirklich schlechten Roman von Ross Thomas gibt es nicht. Aber wenn ich nach dem schwächsten gefragt würde, wäre Dann sei wenigstens vorsichtig (Alexander Verlag) sicher mein erster Kandidat. Wie gesagt, stets in Relation. Der erste Satz ist ein Klassiker: „Es begann so, wie das Ende der Welt beginnen wird: mit einem Telefonanruf um drei Uhr früh“. Auch die Hauptfigur, diesmal mit dem unwahrscheinlichen Namen Decatur Lucas ausgestattet, ist eine typische Ross-Thomas-Figur: Historiker, Rechercheur und Spezialist für die hohe Kunst der Korruption. Das Original, „If you can’t be good“, ist 1973 erschienen, spielt also zur Zeit der Watergate-Affaire und deshalb sind auch größere Teile der Handlung im Watergate-Gebäude angesiedelt. Decatur soll für einen Mud-Digger-Kolumnisten herausfinden, warum ein Senator bestechlich ist und wühlt sich deswegen in eine ziemlich horrible Familiengeschichte. Seltsamerweise bleibt der Roman aber, für Ross Thomas ungewöhnlich, auf dieser Schiene, die sich eher wie ein Ross Macdonald-Roman liest, eben mit Decatur Lucas als mehr oder weniger klassischem Privatdetektiv, und – obwohl es natürlich genug maliziöse Kommentare und Beobachtungen aus dem Washingtoner Politik-Betrieb gibt – ohne die normalerweise toxischen und ätzenden Twists. Irgendwie drängt sich der Eindruck auf, als ob der Großmeister des politischen Thrillers sich einmal an einer pi-novel versuchen wollte, die jedoch für seine Standards unterkomplex ist. Und so erklärt sich vielleicht auch, dass sich die für dieses Sub-Genre oft topische Misogynie einschleicht; eine Untugend, deren sich Ross Thomas ansonsten nicht schuldig gemacht hat. Ein irgendwie unbalancierter, unfertiger Roman, aber wie gesagt: Nur für Ross-Thomas-Verhältnisse.
Ich hatte ja schon Angst, dass Martin Schüllers 111 Tipps und Tricks wie man einen verdammt guten Krimi schreibt (Emons) mal wieder eine Ausgeburt all der unsäglichen Schreibschulen/-kurse sein könnte, bei denen Ahnungslose, Unbedarfte und Hobbyautoren noch ahnungsloseren Möchtegern-AutorInnen erklären, was ein Krimi ist, was geht und was nicht geht, worauf dann nach solchen Maßgaben zusammengezimmerte Manuskripte auf nicht nur meinem Herausgeberschreibtisch landen. Vor allem das in Kreisen ganz hartgesottener Postpubertanten beliebte „verdammt“ im Titel ist ja schon furchteinflößend genug. Schüller aber bringt es fertig, eine ganz einfache Formel auf 232 Seiten auszufalten, die da heißt: Es geht so ziemlich alles, wenn man’s kann. Wenn nicht, nicht. Dafür bin ich ihm richtig dankbar. Da kann man dann auch ruhig darüber hinwegsehen, dass er jede Evidenz und jeden (noch so richtigen) Gemeinplatz – und nur aus solchen besteht das Kompendium – als originelle und brandneue, gar selbstgedachte Einsicht hinstellt, was an sich schon amüsant genug ist, nice eben. Immerhin – aus Nichts ein ganzes Buch zu machen, das ist schon klasse. Das Schönste aber ist: Dieses Buch wird keinen Schaden anrichten. Geht doch.
+++

Leichenberg 08/2018
Giorgio Scerbanenco (1911-1969) Spross einer ukrainischen Immigrantenfamilie und als Journalist und Schriftsteller in jeder Art von Textproduktion zuhause, hatte mit seinen vier Duca-Lamberti-Romanen nicht nur der bis dahin ephemeren italienischen Kriminalliteratur (Ausnahmen wie Leonardo Scascia und Carlo Emilio Gadda bestätigen die Regel) Stimme und Gewicht gegeben. Zwei davon liegen bis jetzt vor: Das Mädchen aus Mailand und Die Verratenen (beide mit sehr instruktiven und klugen Nachworten von Giancarlo de Cataldo resp. Tobias Gohlis ausgestattet). Duca Lamberti ist ein Arzt, der wegen aktiver Sterbehilfe im Gefängnis war, seine Approbation verloren hat und aus verwickelten Gründen für die Mailänder Polizei arbeitet. Mailand ist eine weitere „Hauptfigur“ des Quartetts (1966 – 1969), eine wirtschaftliche boomende Stadt, in die die Nachkriegsmoderne mit allen Konsequenzen Einzug gehalten hat, und zu deren DNA Gewalt und Verbrechen auf allen gesellschaftlichen Ebenen gehören. Und die dennoch nicht geschichtsfrei geworden ist – davon erzählt „Die Verratenen“. Ein fieses Verbrechenpärchen wird ersäuft, warum das so passiert, liegt an Ereignissen während des Faschismus und des Zweiten Weltkriegs, als man mit Verrat fröhlich Karriere machen konnte und auch im neuen Italien weit kommt. Denn auch die neue Bourgeoisie verlangt nach Profit, egal, ob der aus dem Waffenhandel oder aus Erpressung, Zwangsprostitution und Pornographie stammt, davon handelt „Das Mädchen aus Mailand“. Verbrechen ist bei Scerbanenco stets präzise kontextualisiert und vor allem so konstitutiv für die beschriebene Gesellschaft, dass der Kampf dagegen von vornherein aussichtslos ist. Das weiß auch Duca Lamberti, dennoch stürzt er sich ins Handgemenge – er hat sowieso nichts mehr zu verlieren. Seine Methoden sind mehr als fragwürdig, seine moralisch-ethischen Grauwerte erheblich, hard-boiled im Sinne von mentaler Härte, gar Grausamkeit. Dennoch ist er nicht auf eine eindeutige Position irgendwo zwischen Vigilantismus und Legalismus festzunageln. Das liegt an der Prosa Scerbanencos, ein eleganter, schneller und virtuoser Mix aus personalem und auktorialem Erzählen, der alle Möglichkeiten dieses Ansatzes ausreizt. Das Changieren der Erzählperspektiven bis in die Satz-Ebene erlaubt das Einschieben von Kommentaren, kalten Lakonismen, grimmiger Komik, tiefsinniger Reflexion und intelligenter Dialoge. Es verhindert aber vor allem eine vereindeutigende Lesart. Scerbanenco stellt so alle Möglichkeiten des Umgangs mit Gewalt und Verbrechen zur Disposition, auch und gerade die von Duca Lamberti. Das ist unbequem, manchmal prekär, aber auf jeden Fall provokant und riskant. Mehr noch: Duca Lamberti ist eine Figur, die identifikatorisches Lesen bewusst und intentional blockiert, weil er konsistent inkonsistent angelegt ist. Das macht seine Faszination aus und seine auch heute noch aktuelle Modernität: Optionen und offene, böse Fragen statt Lösungen oder falsche Konsensangebote.

Der direkte Einfluss von Scerbanenco ist am deutlichsten bei Carlo Lucarelli zu beobachten. Dessen Figur Commissario de Luca ist ein historisierter Verwandter von Lamberti. Nach einer Pause von fast 21 Jahren (wenn ich richtig sehe) belebt Lucarelli in Italienische Intrige (Folio, kein Zufall) den Polizisten wieder, der im Faschismus und in der Italienische Sozialrepublik (bei uns bekannter als Republik von Salò) schon im Amt war. Jetzt, 1953, geht es um extrem unappetitliche anti-kommunistische Aktionen der italienischen Geheimdienste im eingeschneiten Bologna, die auch geschichtliche Verbindungen zum Faschismus haben. Staatskriminalität mit Mord vom Ekligsten. Und mitten drin der undercover operierende De Luca, der trotzig den Mord an einer Frau aufklären will, der eigentlich von offizieller Seite nur ein Kollateralschaden sein soll. De Luca fühlt sich zurecht instrumentalisiert und versucht sich in einer Art Schubumkehr. Mit düsteren Bildern von Eis, Schnee und Kälte zeichnet der Roman ein deprimierendes Bild eines alles andere als bella Italia – eine Art rechtsfreier Raum, intransparent, menschenverachtend, von Partialinteressen geleitet. Auf jeden Fall irritierend und wenig ausrechenbar. Und deshalb schon fast ein Kommentar zu den heutigen Verhältnissen.
+++

Leichenberg 12/2017
Schlimme Dinge können ganz banal daherkommen. Elisabeth Ebel führt ein wenig sensationelles Leben in Berlin. Sie arbeitet für eine Art Schreibbüro als Korrektorin, obwohl sie ein abgeschlossenes Studium hat. Ihre verwitwete Mutter in Wattenscheid of all places triggert ihr schlechtes Gewissen, nörgelt und meckert an allem, zwingt sie aber alle paar Wochen zu unerquicklichen Besuchen. Elisabeth hatte die eine oder andere gescheiterte Beziehung, hat sich aber ansonsten im stillen Nicht-Glück ganz gut einrichtet. Meint sie. Bis sie sich plötzlich verfolgt fühlt, obwohl sie das nicht belegen kann. Unheil deutet sich an, bleibt aber unscharf. Hat sie tatsächlich einen Mord mit angesehen? Wollte tatsächlich jemand sie vor den Bus schubsen? Hat die Frau, die sie für einen One Night Stand mitgenommen hatte, tatsächlich später ihren Laptop und eine Kamera aus ihrer Wohnung geklaut? In Elisabeth, die Weltmeisterin im Verdrängen und Vergessen, steigen Erinnerungen hoch, die sie eigentlich nicht haben will. Was sie mit ihrer greisen Mutter in der Badewanne getan hat, wie öde und fahl ihre Kindheit und Jugend im öden und fahlen Wattenscheid war, was es mit einer Affäre mit der Gattin eines Kunden auf sich hatte. Schleierwolken überziehen die Welt von Elisabeth und Schleierwolken heißt der sensationell gute Roman von Regina Nössler (konkursbuch). Selten wurde subtiler Horror so leise und so gekonnt erzählt. Nichts ist schrill, nichts sensationell, aber vieles ist grausam, gemein und entschieden fies. Nössler seziert nicht nur grauen Alltag, sondern vor allem Unglück mit virtuoser Präzision, flicht Katastrophen beiläufig ein, nie larmoyant, nie von der Schwere des Erzählten erdrückt, nie gefühlig. Sie schafft es, aus einem liegengebliebenen ICE ein Schreckenskabinett zu machen und die Wohnung eines sozio- und agoraphoben Mannes wird nur durch die Beschreibung zum House of Terror, ohne dass Nössler je zu Schock-Elementen greifen muss. Im Gegenteil, die ganze, im Grunde tieftraurige Erzählung, von Außenseitertum, Gewalt in allen Nuancen und Lebenslügen, Kommunikationslosigkeit und psychischer Verwahrlosung durchzieht ein Unterstrom tiefschwarzer Komik. Das auf den ersten Blick Unspektakuläre des Romans ist reine maliziöse Tarnung, das Buch ist mehr als spektakulär, ein absolutes Schwergewicht – und so ziemlich allem weit überlegen, was gerade als „Psycho-Thriller“ dahergetrampelt kommt. In einer gerechteren und qualitätsbewussteren Welt auf Platz 1 jeder Besten- und Bestseller-Liste. – Anm. d. Redaktion: Siehe auch Claudia Gehrke und Regina Nössler zu TW in dieser Ausgabe.

Die erhebliche Sprengkraft von Oliver Bottinis Der Tod in den stillen Winkeln des Lebens (DuMont) liegt genau in den stillen Winkeln verborgen, die dennoch ganz zentral sind, aber die niemand so richtig auf dem Schirm hat. Bottini siedelt seinen Roman im rumänischen Temeswar an und in Prenzlin (einem fiktiven Dorf in der Nähe von Güstrow) in Mecklenburg-Vorpommern, beides Gegenden, die a priori nichts Sensationelles signalisieren. Aber in beiden Gegenden wütet besonders signifikant die Globalisierung in Gestalt der großindustriellen Agrarindustrie, wo Chinesen, Araber und alle möglichen multinationale Player die lokalen Strukturen der Landwirtschaft zugunsten von Monokulturen zerschlagen – koste es, was es wolle. Ein Mordfall in Rumänien, hinter dem zunächst eine Beziehungstragödie zu stecken scheint, führt den dortigen Ermittler Ioan Cozma nach Deutschland, wo er auf Menschen trifft, die genauso wie er durch die Diktaturen, in denen sie aufgewachsen sind, ähnlich beschädigt worden sind. Die mit vielen Hoffnungen erfolgte Abwicklung des „Kommunismus“ durch einen dann zunehmend rücksichtslosen Turbokapitalismus macht nicht nur Ökologien und Ökonomien kaputt, sondern vor allem Menschen. Cozma hat während der Ceau?escu-Diktatur fürchterliche Dinge getan, die er inzwischen bereut und die zu neutralisieren er durch seine Existenz im „stillen Winkel“ seines Lebens versucht. Für die Leute, die aus Prenzlin nach Rumänien ausgewichen sind, um dort ein neues Leben nach ihren Maßstäben anzufangen, droht die Erkenntnis, dass sie systemischen Dynamiken nicht entkommen können. Was die persönlichen Tragödien nicht erträglicher macht, wie auch ein fieser Killer erfahren muss, der am Ende dann noch nur ein armer Hund ist. Bottini zurrt Privates und Politisches stramm zusammen und das ist bei ihm nicht das genretypische Ausstatten von Hauptfiguren mit privaten Schicksalen, die neben dem Plot herlaufen, sondern konstitutiv. Seine Geschichte muss auf diesen beiden Ebenen spielen, eben weil sie gleichermaßen seine Menschen definieren. Und weil in den unbeachteten Ecken des Kontinents politisch extrem weitreichende Prozesse mit deprimierenden Konsequenzen ablaufen, ist Bottinis Buch explizit politisch (wütende und zornige Untertöne kann und will es nicht unterdrücken) und es ist auch ein gesamteuropäischer (wenn nicht weltweit gültiger) Roman. Großes Kaliber.

Wie lasch und bieder und schlicht dagegen München, das neue Buch des (mit Ausnahme von „Fatherland“) weit überschätzen Robert Harris (Heyne). Seine Romane aus der Antike – vor allem die über Cicero – waren wenigstens unfreiwillig lustig, weil er das alte Rom ohne ein Hauch von Feeling für Alterität in Parametern von heutigen family values und Cicero als Vorsteher einer Londoner oder New Yorker law firm aufgezogen hatte, und auch sein Dreyfuss-Roman „Intrige“ war eigentlich eine Whistleblower-Geschichte nach heutigem Verständnis minus des krass antisemitischen Kerns der historischen Ereignisse. Jetzt also das Appeasement von 1938. Harris versucht, Chamberlains Politik ex post zu legitimieren: Es sei ihm, so die implizite These des Buches, darum gegangen, den unausweichlichen Krieg mit Deutschland noch ein paar Jahre hinauszuschieben, weil die britische Rüstung noch nicht kriegsbereit war. Im Grunde habe er damit Hitler eine Niederlage bereitet, weil der sofort habe losschlagen wollen. Das ist historisch, naja, diskutabel, wenn auch keinesfalls originell. Um die Münchner Konferenz herum bastelt er dann einen schwachen Plot: Eine deutsche Widerstandsgruppe plant den Putsch, möglicherweise auch schon die Ermordung Hitlers, wenn es nur gelingt, den Chamberlain’schen Plan scheitern zu lassen. Weil Hitler sich aber von Chamberlain beschwatzen lässt, entfallen Attentat und Putsch. That’s it und alle gehen nach Hause. Nazi sells, und so hüpfen die üblichen Knallchargen durch’s Bild – Himmler lacht fies, Ribbentrop ist blöd, Mussolini eitel, Daladier verpeilt, die SS ist roh und das diplomatische Corps opportunistisch, das Volk trägt Lederhose und Dirndl und sauft Bier. Ach ja, wo doch Deutsche und Brite so gute Freunde sein könnten wie die beiden jungen Diplomaten, die das jeweils Gute in ihren Nationen verkörpern. Das ganze in Holzschnittprosa, ohne Pointe, ohne Clou. Guido-Knopp-Geschichte mit Laiendarstellern. Einschlafhilfe.

Leichenberg 05/ 2016
Einer der größten Saboteure literarischer Sinnstiftung und ein Magier erzählerischen Fallenstellens war Eric Ambler und eines seiner Meisterweise Die Maske des Dimitrios, den der Hoffmann & Campe Verlag sinnvollerweise wieder auf dem Markt zugänglich gemacht hat. Schon der Einstieg ist ein Musterstück von Verwirrung und ironischem Chaos: Schwergewichtige Parameter wie Kontingent, Vorhersehung und Absurdität werden fröhlich durcheinander gewirbelt, die Hauptperson, der aufgeblasene Trivialautor Latimer, möglicherweise als leicht blödsinnig eingeführt. Das ist schon einmal eine sarkastische Absage an Kriminalromane mit klarem Ordnungswillen, bei denen am Ende alles gut (Mainstream) oder alles böse (Noir) endet. Latimer verbeißt sich in ein Phänomen, eben jenen Dimitrios, eine Art Superverbrecher, der mordend und raubend durch den Mittelmeer- und den Balkanraum marodiert. Mal als politischer Attentäter, mal als Großzuhälter oder als Drogendealer, als Mann fürs Grobe für eine dubiose Investmentbank. Gesucht von ziemlichen allen Polizeien und Geheimdiensten der Gegend, von manchen auch protegiert und geschützt. Er ist ein Phänomen, ein dunkler Schatten, überall und nirgends gleichermaßen. Es gibt keine Fotos, nur haufenweise mehr oder weniger gefälschte Dokumente und als eine Leiche aus dem Bosporus gefischt wird, sind nur eher naive Gemüter davon überzeugt, dass es sich dabei wirklich um Dimitrios handelt, als ob der tatsächlich einen Ausweis bei sich trüge. Das ist vom ganzen production design her deutlich ein Roman aus dem Hier und Heute. Dabei stammt dieser Klassiker aus der weltliterarischen Hall of Fame aus dem Jahr 1939. Er bietet ein beiläufig-lakonisches Panorama der Zwischenkriegsgeschichte, an deren Ende das Unheil schon passiert ist und immer schlimmer wird. Ambler ätzt mit seiner ultracoolen, säureklaren, präzisen und gleichzeitig ambiguen Prosa jede Art von Gewissheit weg. Die Reise ins Ungewisse und in die Angst hat begonnen. Unbehaglich zu beobachten, wie große, sehr große Teile der zur Zeit gängigen Kriminalliteratur dagegen intellektuell und ästhetisch zurückgeblieben oder zurückgefallen erscheinen.
++ ++
Leichenberg 09/2006
Allmählich kann man schon die Uhr danach stellen: Die wirklich interessanten Sachen passieren ausserhalb des Mainstreams. Das Schisma zwischen »Markterfolg« und Qualität wird immer schärfer und verspricht vielleicht sogar irgendwann umzukippen. Dann, wenn dem Mainstream dereinst aufgehen wird, dass man auch mit Qualität Geld verdienen kann.
Nehmen wir zum Beispiel Mirko Schädels Illustrierte Bibliographie der Kriminalliteratur im deutschen Sprachraum von 1796 bis 1945, erschienen in Schädels eigener Achilla Presse. Zwei typographisch hervorragend und auch sonst nach allen Regeln der Buchkunst grandios hergestellte Bände im Schuber – das reine ästhetische Vergnügen mit unverzichtbarem Inhalt. 8981 Positionen listet die Bibliographie auf: ein Forschungsfeld ohnegleichen für die Literaturwissenschaft. Unendliche »Minen & Quellen« für jedes faktengestützte Nachdenken über spezifisch deutsche Kriminalliteratur und zudem, wegen der vielen Cover-Abbildungen, ein buchwerbungshistorischer Steinbruch. Halten wir kurz die Luft an: Das Projekt kostet 175.- ¤, aber für solche Qualität ist kein einziger Cent verplempert. Der Kalkulator manchen Publikumsverlags mag sich in den Allerwertesten beißen, was man mit diesem Projekt und den entsprechenden Vertriebswegen alles hätte … Jaja!
Frank Göhre war schon immer ein eher sparsamer Prosa-Autor – und ein ganz vorzüglicher sowieso. Also freuen wir uns sehr, dass es jetzt einen neuen Roman gibt: Zappas letzter Hit. Erschienen nicht mehr in Göhres Traditionsverlag Rowohlt, sondern bei Pendragon. So ein Wechsel von Großverlag zu Kleinverlag hat heutzutage meistens mit Qualität und Originalität zu tun, die dem Großverlagsmarketing unheimlich sind. Hier auch: Denn Göhres Fortsetzung seiner Kiez-Trilogie aus den 90s, ist ein formal ungewöhnliches und hervoragendes Stück Kriminalliteratur auf der Höhe der Zeit. Göhre verknüpft Zeitgeschehen und Thriller eng anhand der Hamburger Lokalpolitik, bindet seine Geschichte an starke Figuren, die wiederum typologische Ähnlichkeiten mit echten Akteuren der Polit- und OK-Szene haben (Schill, die Nachwehen der Pinzner-Affäre etc.) und läßt dadurch den Gedanken an bloßen Regionalismus gar nicht aufkommen. Es geht ihm nicht um die Abschilderung von Realität, sondern um das Arrangement von präzisen Realien mit den Mitteln der Literatur. Und die sind adäquat dem Sujet angepaßt und stammen nicht aus der Rumpelkiste der angeblich »Hohen Literatur« und deren angeblich überzeitlicher Sprache. So sollen Kriminalromane sein: Erzählungen von Menschen, die sich in einer Umwelt bewegen müssen, in der sie nunmal aus verschiedenen Gründen leben. Nix Sensationelles, aber auch nix Kuscheliges, nix Monströses, aber auch nix Beschwichtigendes. Der extreme thrill des ganz normal Wahnsinnigen, durch den wir alle durchmüssen. – Anm. d. Red.: Siehe auch Frank Göhre zu TW in dieser Ausgabe hier nebenan.
»Zappas letzter Hit« markiert so deutlich den Unterschied zu einem Buch, das möglicherweise ein schöner Roman ist, aber nur so tut, als sei es ein Kriminalroman: Die Süße des Lebens von Paul Hochgatterer (Deuticke). Ambitionierte Literatur, die von Anfang an vor dem Konkreten zurückscheut: »Das Kind« , »der Großvater«, »Er« – so abstrakt entworfene Figuren dienen dazu, einer These über die Welt eine Kriminalhandlung zur Illustration beizuheften. Nicht die narration schafft diese These oder steht für sich selbst, sondern sie folgt einem schon vorher festgelegten Zweck. Und das ist, hat man den Mechanismus entdeckt, dann doch eine mehr oder weniger formale Übung.
Leichenberg 10/ 2000
Schon seit 1952, also volle 48 Jahre, ist Evan Hunter alias Ed McBain im Geschäft. Neuauflagen seiner klassischen Romane um das 87. Polizeirevier der fiktiven Metropole Isola wären zwar auch sinnvoll, aber nicht vordringlich. Denn McBain schreibt und schreibt und schreibt. Er ist neben Simenon vermutlich der produktivste Autor und hat zwar stärkere und schwächere, aber kaum wirklich schlechte Bücher geschrieben. Big Bad City (Europa Verlag) gehört deutlich ins vordere Mittelfeld. Steve Carella und seine Kollegen haben es diesmal mit einer ermordeten Nonne zu tun, die verblüffenderweise Brustimplantate hat, mit einem Einbrecher, der gerne Schokoladenplätzchen backt, aber plötzlich in eine arg blutige Klemme gerät, und mit einem Typen, der sich sozusagen präventiv an Carella rächen will. Entscheidend wie immer bei McBain ist auch hier der Chronik-Charakter. Die Romane spielen im Hier und Jetzt und kommentieren es ohne den Sicherheitsabstand des Historischen. Realitäten kommen roh und direkt aufs Tapet.
Auch Kolumbien wird als Schauplatz immer interessanter. Nach Santiago Gamboa jetzt also Fernando Vallejos Die Madonna der Mörder (Zsolnay) der in krasser Inkongruenz dieses gewaltgeschüttelte Land zu schildern versucht. Ein alternder Roué zieht mit seinem Lustknaben, der ein minderjähriger Auftragsmörder ist, blutspritzend und metzelnd durch Medellín. Dem real-banalen Elend der Gewalt setzt Vallejo mit erlesenen, feinsinnigen Gedanken und köstlichen Reflexionen zu. Ob man für diese Methode gleich Genet oder Céline im Klappentext aufrufen muss, weiss ich nicht genau – gewiss aber macht das Buch frösteln. Ob als Methode oder als Resultat, bemerkenswert ist es auf jeden Fall. Und in gewisser Weise abstossend.
Leichenberg 10/1995
Es ist merkwürdig, daß ausgerechnet in dem Moment, wo Thriller und Kriminalliteratur den deutschen Markt nicht gerade mit berauschend neuen oder aufregenden Konzepten überschütten, sich in Beilagen, Specials und Feuilletons „Krimis“ breitmachen. Dieser mediale Aufwind bringt Merkwürdiges hervor: Die Beutemacher von Bill Brannon (Heyne) zum Beispiel. Man kann anscheinend 39,80 DM für etwas verlangen, was früher als „juicy“, als Heftchenroman durchaus seinen legitimen Platz gehabt hätte. Achtzig Pfennig weniger, nämlich glatte 39,00 DM kann sich Diogenes trauen, von den Käufern einzuziehen: Für den Klassiker „The Beast Must Die“ von Nicholas Blake (1938), auf deutsch als „Das Biest“ erschienen bei Ullstein und Goldmann (1959, 1968 und 1980) und zuerst im Nürnberger Nest-Verlag 1953 in der Übersetzung von Eberhard Gauhe, also genau in der Ausgabe, in der der grandiose Romane jetzt als Mein Verbrechen vorliegt, wobei auf dem Rückentext verkündet wird, Chabrol habe den Roman unter dem Titel „Das Biest muß sterben“ verfilmt.
Rowohlt kann sich trauen, unter dem Titel Steckbriefe. Eine Krimi-Kartei von A – Z von Rudi Kost und Thomas Klingenmaier eine schlecht aktualisierte Sammlung der „Schwarzen-Beute“-Garnituren auf den Markt zu werfen. Achtung: Zum Nachschlagen ist das Werk nicht zu benutzen. Z.B: Der nicht-existierende Jean-Pierre Manchette (gemeint ist vermutlich Jean-Patrick Manchette) lebt anscheinend noch, Detlef, nicht D.B. Blettenberg, lebt überall, nur nicht in Berlin, die bibliographischen Hinweise für Rowohlt-Autoren sind aktualisiert, die von Autoren mit anderen Verlagen nicht unbedingt (Joseph Wambaugh hat anscheinend 1987 aufgehört zu schreiben) usw.usw. Die abenteuerliche Auswahl und die dito Kommentare muß man gor net erst ignorieren.
** **