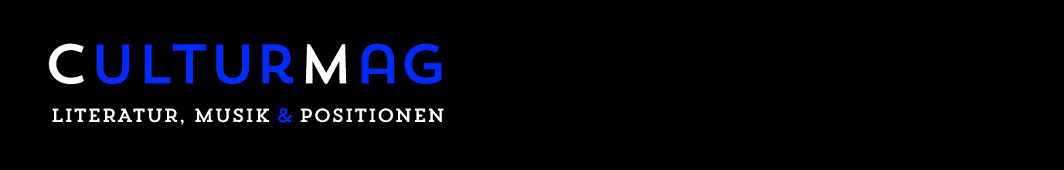Vom Umgang mit der Ungewissheit
Der Ein-Meter-Neunzig-Mann, der Minuten zuvor auf Geheiss der Meisterin vor den brennenden Teelichtern auf die Knie gesunken ist, bricht jetzt in Tränen aus. Das Mozart-Requiem, das aus dem hastig in die Mitte des Stuhlkreises gezerrten Ghettoblasters dröhnt, hat ihm den Rest gegeben, den Damm zum Brechen gebracht. Noch vor einer halben Stunde war er einfach nur ein Mann Ende fünfzig, der keine Erklärung dafür fand, warum es ihm schwer fällt, Emotionen zu zeigen. Ein paar suggestive Fragen und angezündete Teelichter später weiß er jetzt: Sein Vater war ein Nazi und zwar ein richtig hohes Tier. Er trägt die Verantwortung für den Tod von über zehntausend jüdischen Kindern, da er einen geheimen Fluchtweg verraten hatte. „Meines Wissens war mein Vater ein einfacher Dachdeckermeister aus Kassel und hatte mit der NSDAP nichts zu tun.“ – Tja, so leicht kann man sich täuschen, mein Lieber! Jetzt hat er zwar einen Nazi-Verbrecher-Vater, aber dafür auch Emotionen, die ganz ungehindert aus ihm herausschiessen, während er zu Lacrimosa stellvertretend für seinen Vater die Seelen der toten Kinder um Vergebung bittet. Ich bin zwar schon spätestens beim Ghettoblaster ausgestiegen, aber als wir jetzt von der Guruistin dazu animiert werden, den Chor der ermordeten Kinder zu mimen und uns vor dem wimmernden Mann aufbauen, ist endgültig Schluß!

Bis heute habe ich mir nicht ganz verziehen, dass ich nicht sitzen geblieben oder einfach gegangen bin, sondern mich mit den gut fünfzehn anderen Teilnehmern wie eine schlechte Laientheatergruppe um den armen Mann gruppiert habe. Ich stand da zwar ohne das geringste darstellerische Engagement, aber ich habe mitgemacht. Und das, obwohl ich wusste, dass hier nicht nur die Geschichte und das unsägliche Leid von Menschen missbraucht wurde, sondern auch in die Biographie des knienden Mannes eine frei erfundene Geschichte implantiert wurde, die ihm zwar erst einmal eine Erklärung liefern, ihn aber für den Rest seines Lebens nicht mehr loslassen und noch viele, viele Familienaufstellungen buchen lassen würde. – Erst in der Mittagspause stahl ich mich davon. – Eine halbe Monatsmiete ärmer, aber einen Intensivlehrgang zum Thema Gruppendynamik und die Erkenntnis, dass ich so verzweifelt dann doch nicht war, reicher.

Längerfristig betrachtet war es vielleicht sogar eine gute Investition. Denn diese Familienaufstellung blieb der letzte Versuch, durch fremde Hilfe in diesem Leben noch „normal“ zu werden. Besser gesagt, zuerst einmal die Ursache für mein nicht „normal“ sein zu eruieren, denn bevor man den Tumor herausschneiden kann, muss man ja wissen, wo er sitzt. Das versuchte ich seit meiner frühsten Jugend herauszufinden: Durch Gesprächstherapien, Psychoanalyse, Tarotkarten, Traumatherapie und Traumanalyse, schamanische Rituale, Kinesiologie, Astrologie, Meditation und zuletzt eben auch noch durch diese unwürdige Veranstaltung. Durch diese habe ich zumindest erfahren, dass es viele Menschen gibt, die noch wesentlich gestörter sind als ich. Und auch, dass ich manchmal eben genau so funktioniere, aufstehe und mitmache, wie alle anderen auch. Aber an meinem Gefühl des „anders Seins“, des „nicht dazu Gehörens“ änderte das nichts. Und auch an meinem Leiden darunter nicht.
Wer hätte geahnt, dass die große Erlösung so simpel wäre: Eine einfache kleine Pandemie hat gerichtet, woran ich ein halbes Leben gescheitert bin. Und zwar – so größenwahnsinnig, diese Möglichkeit auch nur zu denken, war ich selbst in meinen aller megalomanischsten Phasen nicht – frei nach dem Motto: „Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muß der Prophet zum Berg.“ Die geniale Lösung für mein Problem bestand nicht darin, dass ich so wurde wie alle, sondern dass alle so wurden wie ich.
Es begann mit unspektakulären Dingen: Brotbacken und ausgedehnte Spaziergänge. – Zugegeben, Gewohnheiten, die an Exotik leicht zu überbieten sind – ich wäre auch nie darauf gekommen, unser täglich Brot oder Spaziergänge in sozialen Netzwerken zu posten. Und plötzlich war beides Volkssport geworden. Auf meine anfängliche Verwunderung folgte bald schon Unbehagen: Zwanghafte Toilettenbesuche vor meinen Spaziergängen, ständig kurz vor der Dehydrierung… Ich bin selten weniger als zwei Stunden unterwegs und da muss man eben schon mal. Früher kein Problem: Außer vielleicht an den Wochenenden waren so wenige Menschen in „meinen“ Wäldern und Parks unterwegs, dass ich mich immer irgendwo hinter einen Busch hocken konnte – heute undenkbar. Aber auch sonst: Menschen stören mich nicht nur beim Urinieren, sondern auch beim Denken und viele Menschen verhindern beides gar. Dazu wurde der Spaziergang plötzlich wissenschaftlich ausgeschlachtet: Sportärzte, Psychologen und Promenadologen (sic!) erklärten uns, wie wichtig das Spazierengehen für Volkskörper und -seele sei. Meine diebische Freude über die stibitzten Stunden, über mein komplett unproduktives und absichtsloses Tun, mein stiller Widerstand gegen Neoliberalismus und Selbstoptimierung hatten sich in ihr Gegenteil verkehrt: Von nun an gehörten Spaziergänge auf die To-Do-Liste jedes anständigen, nützlichen Mitglieds der Gesellschaft – Um die eigene Arbeitskraft zu erhalten und um nicht womöglich depressiv zu werden und den Spaß am Konsumieren zu verlieren.
Meine erste Trotzreaktion bestand darin, mich hinter geschlossenen Vorhängen einzuigeln, viele Zigaretten zu rauchen und mein politisches Engagement in die digitale Welt zu verlagern, indem ich auf Facebook Werbeanzeigen wegklickte: „Alle Werbeanzeigen von Nestlé Deutschland verbergen“ – bämm, in your face, Kapitalismus! Das könnte man ein Leben lang machen, denn die abgeschlagenen Drachenköpfe wachsen zuverlässig nach. Gut, dass mein Appetit durch das tagelange vor dem Bildschirm hocken praktisch nicht mehr vorhanden war, denn das Brotbacken hatte ich ganz eingestellt. Lange konnte ich meinen Bewegungsdrang allerdings nicht unterdrücken. Zähneknirschend fing ich an, wieder spazieren zu gehen. Von nun an jedoch nicht mehr im Grünen, sondern bevorzugt entlang den hässlichsten und meistbefahrenen Straßen Berlins. Urinieren ging da zwar auch nicht, aber immerhin blieb ich so weitestgehend von ambitionierten Neu-Spaziergängern verschont.

Aber es ist ja nicht so, dass mein Gefühl der Andersartigkeit aus Spaziergängen und Brotbacken fusste. Es ging um viel Grundsätzlicheres: Es war schon immer schwer für mich, zu beurteilen, ob ich durch das Leben, das ich führe, so geworden bin, oder ob ich mir ein solches Leben ausgesucht habe, weil ich eben bin wie ich bin. Wahrscheinlich Letzteres, denn das Gefühl, nicht dazu zu gehören – egal wozu – begleitet mich schon spätestens seit dem Kindergarten. Das Gefühl blieb stets diffus, war nicht konkret festzumachen. Meine Wertung jedoch tendenziell negativ: Ich war eben irgendwie nicht so schön, nicht so selbstbewusst, nicht so stabil, nicht so unbeschwert, nicht so erfolgreich wie die anderen. Ich dachte, redete, bewegte und benahm mich seltsam. Ich nahm Dinge wahr und mir zu Herzen, die andere nicht bemerkten.

Ich war froh, dass Mix-Tapes aus der Mode gekommen waren – keine der vielen Kassetten meiner Verehrer aus den 90ern kam ohne „Beautiful Freak“ von den Eels aus. – Gut gemeint, vielleicht sogar als ultimativer Liebesbeweis, aber was hätte ich darum gegeben, stattdessen den wesentlich uncooleren Hit „Barbie Girl“ gewidmet zu bekommen. „Life in plastic, it’s fantastic“ – fantastischer auf jeden Fall, als ich zu sein. Erschwerend kam hinzu, dass mein „anders Sein“ ja keinerlei weitere Auszeichnung enthielt, als eben „irgendwie anders“. Wäre ich eine geniale Autistin gewesen, die das U-Bahnnetz von New York detailgetreu, in Blindenschrift aufmalen könnte oder die Frau mit den längsten Beinen der Welt… Aber so war ich eben nur sowas wie eine Cola mit Kirschgeschmack – nicht besonders lecker, aber mal was anderes…
Im letzten Jahr jedoch stellte ich fest, dass mir meine Andersartigkeit durchaus auch manchmal ein Gefühl der Überlegenheit geschenkt hatte. In diesem Punkt unterscheide ich mich wahrscheinlich kein bisschen von all den vielen anderen Sonderlingen: Erst dadurch, dass zum Beispiel die Ungewissheit und die Unvorhersehbarkeit plötzlich in den Fokus der Allgemeinheit rückten, wurde mir klar, dass das Bewusstsein darüber schon immer in mir vorhanden gewesen war. Mir war immer klar gewesen, dass nichts wirklich planbar ist, dass nichts ewig dauert und ich immer in der Lage sein muss, mich veränderten Umständen anzupassen. (Welches Grundschulkind schläft schon mit gepacktem Köfferchen unter seinem Bett und hat einen ausgeklügelten Notfallplan, falls eine schnelle Flucht vonnöten würde?) Was mir nicht klar war, war die Tatsache, dass ich auf diese mühsam erworbene Kompetenz, den Umgang mit der Ungewissheit, auch ein bisschen stolz war: Die Mischung aus prekären Lebensumständen und gewissen Persönlichkeitsmerkmalen hatte mich dazu befähigt, besser auf etwas vorbereitet zu sein, als all die „Normalen“. Ich war quasi eine Soul-Prepperin.

Doch was geschah jetzt? Je länger die Pandemie dauerte, desto weniger einzigartig kam ich mir vor. Plötzlich wurde sich rund um mich rum über „mein Leben“ beklagt: Schon erwähnte unsichere Zukunft, Angst um den Job, zu Hause sitzen, arbeiten wollen und nicht dürfen, Existenzängste, immer flexibel bleiben und sich den neuen Gegebenheiten anpassen, sich gleichzeitig über- und unterfordert fühlen, den Tag selbst strukturieren müssen, sich hilflos fühlen, nicht gebraucht, Einschränkung von sozialen Kontakten (auch wenn das bei mir freiwillig geschieht, weil ich ohne viel Zeit für mich Zeit mit anderen nicht genießen kann), dieses Jahr keine Reise planen können – außer vielleicht an die Ostsee, wenn alles gut läuft… Hallo! Das war doch mein Bier! Meine Realität seit langer Zeit. Ein großer Teil meiner Mitmenschen schien also nicht einmal ein paar Wochen meines Lebens zu ertragen. – Jetzt erst wurde mir bewusst, was ich in all den Jahren geleistet habe… Und auch, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist, mein Anderssein. Jetzt, wo alle so geworden sind wie ich, fehlt es mir sogar ganz schön! Wenn ich könnte, würde ich laut in die Welt rufen: „Ich will mein Leben zurück!“ – aber sogar diesen Satz hat man mir geklaut.
Also, liebe Klone: Findet doch bitte so schnell wie möglich wieder zurück in Euer perfekt funktionierendes und organisiertes Leben! Nehmt die nächste Ausfahrt zur Autobahn und lasst mich auf meiner Holperpiste voller Schlaglöcher allein! Bei näherer Betrachtung gefällt es mir hier nämlich ganz gut. Man kommt zwar nur langsam und mühsam voran, sieht aber dafür auch, was da rechts und links am Wegesrand ist. Und wartet mit dem „normal“ werden bitte nicht, bis alles um Euch rum wieder „normal“ ist, denn das wird es eventuell überhaupt nicht mehr. Ich brauche Euer Anderssein zum Anderssein, und ich kann es kaum erwarten, endlich wieder alleine ich zu sein!

Iris Boss ist Diplomschauspielerin (U.d.K. Berlin) und eine erfahrene Sprecherin. 2021 gründete sie ihr eigenes Studio „CURRY-HAHN-RECORDS“ in Berlin. Neben dem Einsatz als Sprecherin in Fremdstudios bietet sie Sprachaufnahmen, Schnitt, Bearbeitung in professioneller Qualität direkt aus dem Home-Studio an. CURRY-HAHN-RECORDS im Netz.

Mit vielen neuen Hörproben direkt aus dem Home-Studio. Vieles ist gerade in Arbeit und kommt in nächster Zeit dazu.
Iris Boss bei uns.
Iris Boss ist eine passionierte Spaziergängerin. Die Illustrationen in ihrer Kolumne sind oft unterwegs gefunden.