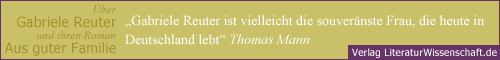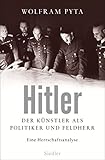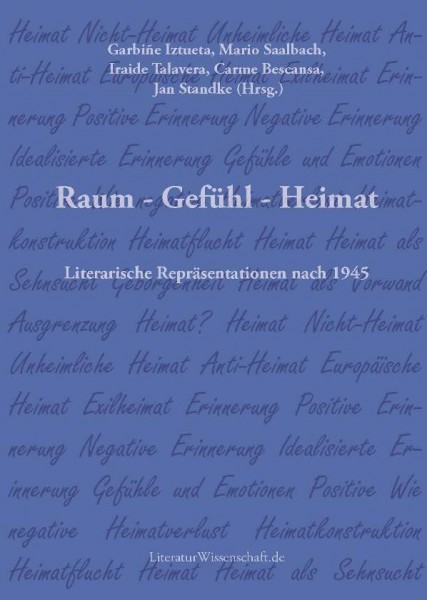Hitlers Tod
Seine Selbstinszenierung als genialer Künstler und die Identifikation mit Friedrich dem Großen
Von Wolfram Pyta
Vorbemerkung der Redaktion (Th.A.): Über den Selbstmord Hitlers vor 70 Jahren, am 30. April 1945, ist viel spekuliert worden. Die Geschichten, die über seine Todesarten verbreitet wurden, bis hin zu der von Stalin geförderten, dass er gar nicht tot sei, sondern geflüchtet, und die Umstände der späteren Untersuchungen dazu, nahmen vielfach groteske Formen an. Weitgehend gesichert ist, dass er sich erschossen hat.
Das eben im Siedler Verlag erschienene Buch des an der Universität Stuttgart lehrenden Historikers Wolfram Pyta mit dem Titel „Hitler. Der Künstler als Politiker und Feldherr. Eine Herrschaftsanalyse“ beteiligt sich an diesen Spekulationen nicht. Das letzte Kapitel, das wir hier in gekürzter Fassung mit freundlicher Genehmigung des Autors und des Verlages veröffentlichen, handelt zwar von Hitlers Tod, die Ausführungen dazu stehen aber in engem Zusammenhang mit den dominanten Fragestellungen Wolfram Pytas. Er gehört zu jenen Historikern, die Politik- und Kulturgeschichte miteinander verbinden. Er sucht dabei vor allem auch die Nähe zur Literaturwissenschaft.
„Der Verfasser geht von dem Diktum des Philosophen und Literaturwissenschaftlers Walter Benjamin aus, wonach der Nationalsozialismus die ‚Ästhetisierung der Politik’ sei“, erklärt Pyta in der Einleitung. Die Frage nach den dynamischen Austauschbeziehungen von Kunst und Politik rückt er ins Zentrum seiner Hitler-Studie, denn: „Der Politiker Hitler ist ohne den Künstler Hitler nicht denkbar.“ Ein weiterer und noch wichtigerer Gewährsmann dafür ist ihm Thomas Mann, der in dem 1938 und 1939 mehrfach publizierten Essay „Bruder Hitler“ widerwillig zugestanden hatte: „Aber muß man nicht, ob man will oder nicht, in dem Phänomen eine Erscheinungsform des Künstlertums wiedererkennen?“ Weit weniger bedeutsam als der Aquarellist und Maler Hitler ist für Pyta im Hinblick auf dessen „politische Theatralität“ allerdings der „verhinderte Theaterarchitekt und passionierte Wagnerianer Hitler, der die Wagner-Aufführungen an der Hofoper in Wien, der ersten Adresse unter den deutschsprachigen Musiktheatern, erlebte“.
Zur Legitimation seines politischen und militärischen Führungsmonopols griff Hitler später auf ein Konzept zurück, das in der Kunst- und Literaturgeschichte des 18. Jahrhunderts entwickelt wurde und mit dem es ihm gelang, eine Form charismatischer Herrschaft zu etablieren, die sich über alle bürokratischen und rationalen Regeln des Regierens erhaben wähnt: die Selbststilisierung zum Genie. Zum Vorbild wurde ihm dabei Friedrich der Große bis hin zur Inszenierung des eigenen Todes.
Pytas Buch begreift sich als „Beitrag zur Verbrechensgeschichte des Nationalsozialismus. Wie kein Zweiter in dem an Terror und Verbrechen wahrlich nicht armen 20. Jahrhundert hat Hitler die Legitimation für seine Untaten aus einer ästhetischen Aufladung des politisch-militärischen Komplexes hergeleitet. Seine Herrschaft verband Künstlertum, charismatische Aufführungspraxis, weltanschaulichen Fanatismus und militärisches Führungsmonopol auf eine so explosive Weise, dass Kriegführung und Holocaust untrennbar miteinander verwoben waren.“
Mit dem letzten Kapitel des Buches über Hitlers Tod („Der Schattenmann: Hitler und Friedrich der Große“ ) variiert Pyta die wesentlichen Aspekte der von ihm erzählten und analysierten „Verbrechensgeschichte“ im Blick auf ihr Ende vor 70 Jahren.
Als Künstler, Staatsmann und Feldherr in einer Person war Friedrich der Große die einzige Gestalt der deutschen Geschichte, an der Hitler sich messen wollte. Als er den militärischen Untergang nahen sah, suchte er noch intensiver als zuvor nach historischen Vorlagen bei Friedrich. Der Rekurs auf die wundersame Rettung Preußens im Siebenjährigen Krieg war gewissermaßen die historische Verheißung, dass man auch eine so schwere Krise überstehen konnte; und als Hitler sich schließlich mit seinem militärischen Scheitern abfinden musste, suchte er das verehrte Vorbild noch in der Art und Weise seines Abgangs nachzuahmen.
Hitler war im Führerhauptquartier zu einer für die Öffentlichkeit nahezu unsichtbaren Figur geworden; sein einziger noch verbliebener Zugang zur Welt war der über die Karten. Bis zur allerletzten Lagebesprechung am 29. April 1945 führte er den Krieg von einem Kartentisch aus, der den nur etwa 15 Quadratmeter großen Lagerraum im „Führerbunker“ unter der Berliner Reichskanzlei nahezu vollständig ausfüllte. Als die Lagevorträge noch im überdimensionierten Arbeitszimmer Hitlers in der „Neuen Reichskanzlei“ stattfanden, hatte ein riesiger marmorner Kartentisch zur Präsentation der Karten gedient. Hitler hatte dieses Arbeitszimmer bis zu seiner Rückkehr nach Berlin im November 1944 kaum seiner eigentlichen Bestimmung zugeführt, da er nie wie ein herkömmlicher Regierungschef Akten wälzte. Es ist bezeichnend, dass dieses Arbeitszimmer erst genutzt wurde, als Hitler dort an einem Kartentisch seine eigentliche Funktion ausübte – für das Führen eines Krieges benötigte er schließlich keinen Schreibtisch, sondern einen gigantischen Kartentisch. Der Kartentisch war Hitlers militärisches Gehirn, ohne den Kartentisch war der oberste Kriegsherr verloren; und so ist es kaum verwunderlich, dass er sogar während seiner Krankheit im Oktober 1944 einen Kartentisch in seinem Schlafzimmer aufbauen ließ. Der Kartentisch gehörte zum Feldherrn Hitler wie die militärische Schirmmütze, ohne die er sich seit Kriegsbeginn nie im Freien sehen ließ. Ein Kartentisch rettete ihm schließlich sogar das Leben, weil das massige Möbelstück beim Attentat Stauffenbergs die Wucht der Sprengstoffexplosion merklich abschwächte.
Hitler vermochte sich die Welt vom Führerhauptquartier aus nur noch kartographisch zu erschließen. Zwei stundenlange Lagebesprechungen Tag für Tag strapazierten seine Aufmerksamkeit so stark, dass er die „Teegespräche“ ab zwei oder drei Uhr in der Früh zur Entspannung dringend benötigte, um die kartographisch generierten Imaginationen wenigstens für ein paar Stunden zu verscheuchen. Seinem Adjutanten Richard Schulze-Kossens erklärte er: „Sonst sehe ich im Dunkeln immer noch die Generalstabskarten vor mir und mein Gehirn arbeitet weiter und es dauert Stunden, bis ich davon loskomme. Mache ich dann Licht, kann ich genaue Karten von jeder Heeresgruppe zeichnen.“ Der oberste Befehlshaber war überzeugt davon, dass der Blick auf die Generalstabskarte ihm alle Informationen lieferte, die er zur Führung des Landkriegs benötigte. Der Luftkrieg blieb ihm dagegen stets suspekt, weil er über diesen keine kartographische Macht ausüben konnte: Über den Wolken endete der visuelle Gestaltungsanspruch des Festungsbaumeisters Hitler.
Hitler klammerte sich an die Karten, weil er ihnen bis zum Schluss seinen künstlerischen Willen aufzwingen konnte. Wie jede visuelle Repräsentation bedurfte auch die Lagekarte einer phantasievollen Auslegung, einer Bildinterpretation, die man durch Maßstabsveränderungen beeinflussen konnte. Seit Sommer 1944 jonglierte Hitler mit Lagekarten in unterschiedallenlichen Maßstäben und bestand gelegentlich sogar darauf, dass Karten im Maßstab 1 : 5000 vorgelegt wurden. So konnte er das Kriegsgeschehen gewissermaßen durch Heranzoomen entdramatisieren: Wenn man vom Standardmaßstab 1 : 300 000 abwich, konnte das Kriegsgeschehen auf kleinräumige Kampfabschnitte eingegrenzt werden, womit die Frontlage viel von ihrer Bedrohlichkeit einbüßte. Ohnehin vermittelten die Lagekarten immer nur einen Überblick über den Frontabschnitt einer Heeresgruppe; nie bildeten sie die Gesamtlage ab. Hitler verstieß damit gegen das klassische Gebot, dass sich der Feldherr vom Feldherrnhügel aus einen Überblick aus der Vogelperspektive verschaffen müsse. Wo der kartographische Blick auf das Ganze ernüchternd wirke, präferierte Hitler die Fixierung auf einzelne Frontabschnitte. Die konsequente Fortsetzung dieser räumlichen Verkleinerung des Krieges bestand darin, dass Hitler seit dem 2. April als Verteidiger von Berlin fungierte und damit – sehr zum Unwillen des OKW – die Verantwortung für die Gesamtkriegführung aus der Hand gab.
Im Unterschied zum Maßstab war die Zahl eine stets gleichbleibende Größe, an der es nichts zu rütteln gab. Das Kriegsgeschehen auf rechenhafte Eindeutigkeit herunterzubrechen, hatte Hitler immer strikt abgelehnt; die immanente Logik einer zahlenmäßig kontrollierten Kriegführung war für ihn unvereinbar mit seinem ästhetisch generierten Führungsanspruch. Zwar existierte eine zahlenmäßig exakte Aufstellung der personellen und materiellen Ausstattung der eingesetzten Divisionen, die Hitler allmonatlich vorgelegt wurde. Aber Hitler ignorierte diese nüchternen Zustandsberichte wohlweislich, weil er der Magie der Kartendarstellungen weiterhin vertraute. Dabei hatte ihm Generalstabschef Halder zugearbeitet, indem er schon zu Beginn des Jahres 1942 Anweisung erteilt hatte, die Feindlage kartographisch zu schönen und die zahlenmäßig bedrohlichen Kräfteverhältnisse an der Ostfront durch manipulative Eingriffe herunterzuspielen. Halder selbst reichte die Hand dafür, dass sich die Heeresführung künstlich blind machte, indem sie auf eine kartographische wie rechenmäßige Kalkulation gemäß der validen Informationen insbesondere der überaus professionellen „Feindbeobachtung“ bewusst verzichtete.
Indem Halder die für Feindbeobachtung zuständigen Generalstabsoffiziere anwies, bei der Lagebeurteilung nicht quantifizierbare Kriterien wie Kampfkraft und fanatischen Durchhaltewillen an prominenter Stelle einzupreisen, leistete er einer Entwicklung Vorschub, welche die Kriegführung von einer rationalen, zahlengestützten Grundlage entkoppelte. Daher konnte Hitler die validen Erkenntnisse der für Feindbeobachtung tätigen Einheiten als unerheblich und geniewidrig abkanzeln. Als der Leiter der Abteilung „Fremde Heere Ost“ des Generalstabs, Oberst Reinhard Gehlen, Hitler bei einem Vortrag im Winter 1944/45 anhand nüchterner Zahlenkolonnen über sowjetische Angriffsvorbereitungen an der Weichsel-Front in Kenntnis setzen wollte, fuhr dieser ihn an: „Ich lehne eine solche Arbeit des Generalstabs ab. Die Absichten des Feindes erkennen und daraus führungsmäßige Schlüsse ziehen wollen, können nur Genies, ein Genie aber wird sich niemals mit derartig handwerksmäßiger Kleinarbeit befassen.“ Es ist entlarvend, dass Hitler in den Lagebesprechungen operative Anweisungen niemals auf der Grundlage exakter tabellarischer Auflistungen erteilte, weil er seine Entscheidungsfreiheit nicht durch ein Zahlenkorsett einengen lassen wollte. Zahlenangaben steuerte er nur bei, wenn sie sich für seine Ansichten instrumentalisieren ließen – und dann kramte er aus seinem durchaus bemerkenswerten Zahlengedächtnis 19 Angaben hervor, die einer gewissen Plausibilität nicht entbehrten und die Anwesenden nicht selten verblüfften. Hitler konnte mit seinen Zahlen nach Belieben jonglieren, weil es für die Teilnehmer an den Lagebesprechungen keinerlei tabellarische Überprüfungsmöglichkeiten gab. Allem Anschein nach sind während der Lagebesprechungen nie quantifizierbare Unterlagen verteilt worden, die den Teilnehmern eine argumentative Hilfe hätten sein können; und das Nachfragen nach exakten Zahlen war verpönt, weil dies einen unerlaubten Vorstoß in den Arkanbereich des „Führers“ bedeutete. Auf diese Weise entwertete Hitler die Zahl als unbestechliche Kontrollinstanz seiner Kriegführung.
Hitlers Aversion gegen die Macht der Zahlen zieht sich wie ein roter Faden durch seinen Politikstil. Schon 1923 hatte er kategorisch erklärt: „Nicht die Zahl gibt den Ausschlag, sondern der Wille.“ Da Hitler seine Herrschaft auf das Wort gründen wollte, lehnte er mit Demokratie und Kapitalismus jene Formen politischer und ökonomischer Verfasstheit ab, die jedem Stimmbürger dasselbe zahlenmäßig verbriefte Gewicht zumessen und bei denen eine exakte zahlenmäßige Bilanzierung als Indikator der Wirtschaft fungiert.
Je mehr Hitler in seiner Funktion als Feldherr aufging, desto mehr trachtete er danach, seine Entwurfsfreiheit nicht durch ein phantasietötendes militärisches Zahlenwerk einschränken zu lassen. Daher konnte er auf der Karte mit Armeen operieren, die in ihrer kartographischen Zeichenhaftigkeit eine Kampfkraft vortäuschten, die längst nicht mehr vorhanden war. Die durch Fähnchen und taktische Zeichen markierten Einheiten waren personell und materiell längst auf ein nicht mehr vollwertiges Minimum geschrumpft. Die Markierung auf der Karte täuschte darüber hinweg, dass im Jahr 1945 fast nur noch zusammengewürfelte Einheiten aus Ersatzleuten ohne Kampferfahrung an die Front geworfen wurden, die weitgehend auf schwere Waffen verzichten mussten und deren Beweglichkeit aus Mangel an Treibstoff eingeschränkt war. Indem Hitlers Einbildungskraft Schrumpfdivisionen in reguläre Divisionen verwandelte, bürdete er den Befehlshabern Unmögliches auf. Noch im „Führerbunker“ dirigierte er Phantomdivisionen, mit denen er die Schlacht um Berlin siegreich beenden wollte. Erst als sich am 22. April 1945 nicht mehr verheimlichen ließ, dass die Rote Armee bereits in die Außenbezirke Berlins vorgedrungen war, gab er den Krieg verloren.
Hitlers Flucht in die Simulation wird auch daran ersichtlich, dass er im Februar 1945 täglich viele Stunden damit zubrachte, sich in das von seinem Lieblingsarchitekten Hermann Giesler erstellte Modell der geplanten Donau-Ufer-Bebauung seiner Heimatstadt Linz zu vertiefen. Dieses Sich-Versenken in eine nach seinen Vorstellungen gestaltete Architekturvision war Ausdruck seiner Passion für die Baukunst und zeugt zugleich von seinem Bestreben, die reale Welt auf artifizielle Weise maßstabsgetreu zu verkleinern. Wie Hitler sein Wunschbild vom Kriegsgeschehen auf die Karte projizierte, so bewegte er sich in seiner Phantasie in einer idealen Stadtlandschaft, wenn er andächtig vor einem Modell aus Gips und Sperrholz verharrte und den Raumeindruck dieser Miniaturausgabe des neuen Linz in sich förmlich einsog. Als sein Untergang durch den von ihm selbst entfachten Weltenbrand nahte, schloss sich der Kreis: Hitler kehrte zu seinen architektonischen Anfängen zurück. Auch dass er seine letzten Lebenswochen in einem Bunker verbrachte, verweist auf diese Ursprünge; schließlich hatte Hitler seine architektonische Expertise nicht zuletzt im Befestigungswesen ausgelebt. Daraus resultierte sein reges Interesse am Bau von Bunkeranlagen; folgerichtig schaltete er sich 1935/36 in den Bau des Luftschutzkellers unter der Reichskanzlei ein und ebenso in den 1943 beschlossenen Ausbau zu einem absolut bombensicheren Unterstand, der dann 1945 zur militärischen Kommandozentrale Hitlers wurde und in dem er seinem Leben am 30. April 1945 ein Ende setzte. Hitlers Detailversessenheit kam unter anderem darin zum Ausdruck, dass er in seine präzisen Anweisungen auch Erkenntnisse aus der Anlage des Westwalls einfließen ließ; insofern spiegelt der Bau des „Führerbunkers“ auch den Fortschritt bei der Errichtung unterirdischer Befestigungen wider.
In der Bunkeranlage bewohnte Hitler seit Anfang 1945 einen ca. 3,5 mal 3,2 Meter großen Raum, der ihm als Wohn- und Arbeitszimmer diente. In diesem letzten halbwegs privaten Refugium gab es nur einen Kunstgegenstand – ein Porträt Friedrichs des Großen, das wie kein Zweites die visuellen Vorstellungen der Nachwelt vom „Alten Fritz“ geprägt hat: eine Kopie des 1781 von Anton Graff angefertigten Bildnisses des Preußenkönigs, das diesen nicht als strahlenden Helden und Feldherrn zeigt, sondern als einen von den Zeitläuften gezeichneten Herrscher im Herbst seines Lebens. Hitler hatte dieses Gemälde schon 1934 erworben; es sollte ihm nachreisen und ihn auf allen wichtigen Lebensstationen begleiten. Dass Hitler den gealterten Friedrich immer in seiner Nähe wissen wollte, offenbart, wie sehr er sich an den großen Preußenkönig anlehnte. Dieser diente ihm mit seiner Verschmelzung von Künstlertum, Feldherrntum und Staatskunst so sehr als Vorbild, dass er ihn am Ende seines Lebens auch äußerlich zu imitieren suchte. Hitler bezog aus dem Exempel Friedrichs nicht nur historische Wegzehrung, sondern ahmte den Preußenkönig habituell so sehr nach, dass er auch seinen Abgang aus der Geschichte nach seinem großen Vorbild zu gestalten suchte.
Je länger der Zweite Weltkrieg dauerte und je kritischer die militärische Lage des Reiches wurde, desto mehr suchte Hitler Anlehnung an Friedrich den Großen. Seit 1944 gehörte die Bezugnahme auf die Krisenbewältigungsstrategie des Preußenkönigs zur eisernen Ration von Hitlers Geschichtspolitik. Hitler legte dabei eine Deutung des preußischen Überlebens im Siebenjährigen Krieg vor, die überaus erhellend ist für seine eigene Art der Kriegführung. Denn hier bricht sich eine Vorstellung vom Krieg Bahn, die den Krieg entrationalisierte, indem sie – unter expliziter Anlehnung an Friedrich den Großen – die Berechenbarkeit des Kriegsausgangs auch bei objektiv ungünstigen Rahmenbedingungen verwirft und stattdessen systematisch ein Einfallstor für die Macht der Zufalls errichtet. Diese Kriegführung beruft sich auf die Erhebung des Krieges zur Kunst, das heißt die Verortung des Krieges in einer Sphäre, in der herkömmliche Wissensregeln entwertet sind und Platz ist für die Entfaltung des mirakulös Unvorhersehbaren. Es war daher nur folgerichtig, dass sich Hitler bei der Unterwerfung des Krieges unter die Herrschaft des Künstlers Hitler auf das Erfolgsgeheimnis des Künstler-Feldherrn Friedrich berief. Denn schon der Preußenkönig hatte seine militärische Selbstbehauptung im Siebenjährigen Krieg letztlich der geheimnisvollen und nicht steuerbaren Macht des Zufalls zugeschrieben, die nicht kalkulierbar sei und am Ende jenen zuteilwerde, die von den Musen geküsst und dem Irrglauben einer wissenschaftlichen Enträtselung des Krieges nicht erlegen seien.
Hitlers Einschätzung, dass es sich bei Friedrich dem Großen im Kern um einen genialen Hasardeur gehandelt habe, der in einer für Preußen günstigen Konstellation alles auf eine Karte gesetzt habe, kam nicht von ungefähr. Misserfolge hätten den König nicht aus der Bahn geworfen, weil er der Geschichtsmächtigkeit des Zufalls vertraut habe; denn selbst in vermeintlich aussichtslosen Situationen konnte ein Zufall – wie im Januar 1762 der Tod der russischen Zarin Elisabeth – das Blatt wenden. Hitler war immer schon ein politischer Spieler gewesen, der auf seine Fortune vertraute. Schon 1929 hatte er formuliert: „Nun ist das ganze Leben … nichts anderes als ein Vabanque-Spiel.“ Friedrichs Wirken scheint ihn in dieser Auffassung noch bestärkt zu haben; so ließ er sich am Vorabend des Zweiten Weltkriegs nicht von der Beistandszusage Großbritanniens an Polen von seinem Kriegskurs abbringen: „Ich habe in meinem Leben immer va banque gespielt.“ Als oberster Befehlshaber der Wehrmacht bekannte er sich im kleinen Kreis immer wieder zu diesem Prinzip; gerade wenn er keine militärfachlichen Gründe für seine militärischen Führungsentscheidungen an führen konnte, pflegte er gegenüber der Generalstabselite zu erklären: „Er müsse eben Hasard spielen.“
Warum konnte Hitler ignorieren, dass Welten zwischen dem Siebenjährigen Krieg und dem Zweiten Weltkrieg lagen? Warum blendete er die völlig unterschiedliche Mächtekonfiguration aus? Es war die ästhetische Aufladung von Politik und Krieg, die den Preußenkönig in diese einzigartige Position einrücken ließ. 200 Jahre vor Hitler hatte zum ersten und bis dahin einzigen Mal in der neueren deutschen Geschichte ein Herrscher die militärischen und politischen Geschicke bestimmt, der sein Leben eigentlich den Musen hatte weihen wollen. Hitler bemühte ausdrücklich diese Tradition, wenn er anmerkte, „daß er als musischer Mensch gerade vom Schicksal dazu ausersehen wurde, diesen schwersten aller Kriege für das Reich zu führen. Aber das ist ja auch bei Friedrich dem Großen der Fall gewesen. Er war ja eigentlich auch nicht zu einem Siebenjährigen Krieg, sondern zu Tändelei, Philosophie und Flötenspiel bestimmt.“ Es war Friedrichs Künstlernatur, die ihn für Hitler zur größten Gestalt der deutschen Geschichte werden ließ. Schon in seinen politischen Anfängen hatte Hitler die Einzigartigkeit des großen Königs herausgestellt. In militärischer Hinsicht in seine Fußstapfen zu treten, erschien ihm nicht vermessen, weil es dazu keiner Ausbildung als Berufsmilitär, sondern allein künstlerischer Inspiration bedurfte. Wenn sich Friedrichs größte Erfolge auf dem Schlachtfeld „auf Eingebungen des Augenblicks stützten“, dann konnte der verhinderte Theaterarchitekt Hitler dem Flötenspieler von Sanssouci in der Art der Kriegführung nacheifern.
Daraus erklärt sich auch, warum Hitler bis weit in den April 1945 hinein ernsthaft auf eine schicksalhafte Wendung des Kriegsgeschehens zu seinen Gunsten hoffte. Hitler räumte dem Zufall einen ähnlich hohen Stellenwert ein wie sein Vorbild Friedrich – und das führte dazu, dass die fundamentalen Unterschiede zwischen militärischen Auseinandersetzungen monarchisch verfasster Staatswesen, in denen ein Thronwechsel in der Tat politische Ausschläge nach sich ziehen konnte, und ideologisch aufgeladenen Volkskriegen verwischt wurden. Im Frühjahr 1945 war ein militärischer Endsieg des Reiches selbst für Hitler in unerreichbare Ferne gerückt. Doch für aussichtslos hielt er die Lage nicht, denn das Beispiel Friedrichs flößte ihm Hoffnung ein, dass ein Bruch der Anti-Hitler-Koalition die deutschen Chancen schlagartig verbessern würde. Hitler-Deutschland ist im Zweiten Weltkrieg nicht von einer oder von zwei Mächten besiegt worden – es war die in dieser Art einzigartige Kombination der militärischen, wirtschaftlichen und politischen Potenzen der drei mächtigsten Imperien, die Hitler zur Strecke brachte. Nur weil sich die Sowjetunion, Großbritannien und die Vereinigten Staaten von Amerika im Kampf gegen die menschenverachtende nationalsozialistische Herrschaft zusammengefunden hatten, konnte die Welt von Hitler befreit werden. Dass sich die beiden kapitalistischen Demokratien ausgerechnet mit der kommunistischen Diktatur zu einer Allianz vereinigt hatten, erschien Hitler und seinen engsten Mitarbeitern so unnatürlich, dass sie an diesem Punkt auf eine Wiederholung der Konstellation des Jahres 1762 hofften, als Russland wegen eines dynastischen Personalwechsels aus dem Krieg gegen Friedrich ausschied und sich damit die Lage auf einen Schlag zugunsten Preußens wendete. Friedrich wurde mithin als Kronzeuge dafür in Anspruch genommen, dass der historische Zufall die vermeintlich nur vom Willen der eingefleischten Hitler-Gegner zusammengehaltene Koalition sprengen könne. Am 6. Februar 1945 führte Hitler in kleinem Kreis aus: „Wie der große Friedrich, so stehen auch wir einer Koalition mächtiger Feinde gegenüber. Aber auch Koalitionen sind Menschenwerk, gehalten von dem Willen einzelner weniger.“
Allerdings nahmen Stalin, Roosevelt und Churchill in Hitlers Augen nicht denselben Rang ein: Stalin war für ihn ein Politiker, mit dem er ins Geschäft kommen konnte, wenn die militärischen und politischen Voraussetzungen dafür geschaffen waren; dies hatte der Hitler-Stalin-Pakt gezeigt. Roosevelt und Churchill schätzte er hingegen als seine eigentlichen politischen Widersacher ein; aber auch hier konnte ein Personalwechsel an der Spitze eine völlig neue Konstellation schaffen. „Ein Churchill kann verschwinden, und alles ändert sich.“ Um dem Zufall ein Eingreifen in den Lauf der Geschichte zu ermöglichen, müsse Deutschland so lange wie möglich durchhalten und seine militärische Kraft bewahren, so dass es im Falle eines Bruchs der Koalition als verhandlungsfähig erscheine. Diese Marschrichtung gab Hitler in seiner letzten Ansprache an die Befehlshaber der Wehrmacht der militärischen Elite mit auf den Weg, als er sie zur Mobilisierung der letzten Anstrengungen zu motivieren suchte. Dabei griff er mehr denn je auf Friedrich den Großen als Stärkungsmittel zurück. Hitler frischte alte Lektüreerfahrungen auf und vertiefte sich unter anderem in das umfangreiche Briefwerk des Königs. Der Friedrich-Bewunderer Goebbels, der sich später ebenfalls mit der einflussreichen, schon Mitte des 19. Jahrhunderts erschienenen Studie des schottischen Literaten Thomas Carlyle über Friedrich beschäftigte, konnte immer wieder feststellen, wie genau Hitler dieses umfangreiche Werk kannte. Auch mit der erneuten Aneignung dieses Werkes brachte Hitler unmissverständlich zum Ausdruck, dass er wie der von Carlyle zum Heroen verklärte Friedrich noch in scheinbar aussichtslosen Situationen durchhalten werde.
Das erhoffte friderizianische Mirakel schien wahr zu werden, als US-Präsident Roosevelt am 12. April 1945 unerwartet verstarb – und damit jener Widersacher Hitlers ausschied, den dieser als seinen Hauptgegner ansah. Roosevelt war für Hitler nur „der Auserwählte des Weltjudentums“, der die USA jüdischen Interessen untertan gemacht habe. Dass die USA nicht den scheinbar bewährten Kurs des Isolationismus fortgesetzt und sich stattdessen in europäische Belange eingemischt hatten, führte Hitler im Kern darauf zurück, dass der „Judenlakai“ Roosevelt sie zu dieser Politik verleitet habe. Daher musste ihm das Ableben Roosevelts wie ein Geschenk der Vorsehung erscheinen: Nun würden die USA aus dem Bann jüdischer Interessen gelöst und hätten keinen Anlass mehr, sich um der eigensüchtigen Interessen dieser fremden Rasse willen in Europa zu engagieren und damit die Geschäfte anderer zu besorgen. Als Goebbels ihm den Tod Roosevelts telefonisch meldete, waren beide enthusiasmiert und verglichen dieses Ereignis mit dem Tod der russischen Zarin im Siebenjährigen Krieg.
Gab der Tod Roosevelts nicht Anlass zu der Hoffnung, dass die USA unter dem Nachfolger Truman nicht mehr mit der Sowjetunion an einem Strang ziehen würden? Stand nun nicht der sehnlichst erwartete Zerfall der Anti-Hitler-Koalition bevor? Hitler hatte jedenfalls vorgesorgt und deutliche Signale der Verständigungsbereitschaft an die Sowjetunion gesandt. Zum Nachfolger des Generalstabschefs Guderian, der mit einem Sonderfrieden mit den Westmächten geliebäugelt hatte, hatte er Anfang April 1945 Hans Krebs bestimmt, der als Assistent des Militärattachés bis 1941 in Moskau tätig gewesen war, fließend Russisch sprach und geradezu prädestiniert war, auf Avancen Moskaus einzugehen, wenn sie denn erfolgten. Den Deutschland bei einem Bruch der Allianz zufallenden Handlungsspielraum gedachte Hitler zu nutzen, um mit der Sowjetunion zu einem Arrangement zu gelangen. Diese Linie hatte er bereits seit 1943 abgesteckt; und noch 1945 zählte er zu den vehementen Verfechtern einer Ostlösung, während Himmler und Goebbels einzig Sondierungen mit den Westmächten für aussichtsreich hielten. Der politische Gehalt solcher Absichten lässt sich nicht evaluieren, weil die Anti-Hitler-Koalition bis zum Untergang Hitlers hielt: Mit einem Menschheitsverbrecher, der sich außerhalb aller zivilisatorischen Werte gestellt hatte, konnte es keine Verhandlungen geben, wenn der militärische Triumph zum Greifen nahe war.
Für Hitler war Friedrich der Große auf der Ebene der Sinnkultur in Gestalt seiner eigenen schriftlichen Hinterlassenschaften wie der über ihn verfassten mythosprägenden Texte omnipräsent. Aber auch in performativer Hinsicht sollte der Preußenkönig für ihn seit 1943 eine überragende Bedeutung erlangen: Hitler ging zunehmend darin auf, Friedrich in seiner Lebensführung zu imitieren. Er gefiel sich darin, der Gestalt seines großen Vorbilds immer ähnlicher zu werden. Pointiert formuliert: Hitler führte in seinen beiden letzten Lebensjahren den alt gewordenen, von der Kriegführung gezeichneten, despotischen und unbelehrbaren „Alten Fritz“ auf. Dies war keine für die große Bühne der Öffentlichkeit bestimmte Aufführung, sondern wurde nur jenen geboten, die Hitler in der Abgeschiedenheit des Führerhauptquartiers regelmäßig zu Gesicht bekamen. Es war letztlich der Rückzug des politischen Auftrittskünstlers Hitler auf die einzige Rolle, mit der er sich vorbehaltlos identifizieren konnte, weil darin Kunst, Politik und Militär eine Einheit bildeten. Nur der Privatmann Hitler konnte in die Rolle des „Fridericus redivivus“ schlüpfen, weil sonst der Genieanspruch gefährdet gewesen wäre. Denn ein Genie darf keinen Körper feilbieten, der vom Verfall gezeichnet ist. Als in den Olymp des militärischen Hauptquartiers entrückter Feldherr konnte Hitler – so lange es irgend möglich war – seinen Genieanspruch proklamieren lassen, aber dann musste der Hitler aus Fleisch und Blut vor der Öffentlichkeit verborgen werden.
Als Wiedergeburt des großen Königs konnte sich Hitler nur deshalb in Szene setzen, weil ein visuelles Dispositiv Friedrichs abrufbar war. Friedrich lebte in der Erinnerung der Deutschen nicht als der strahlende junge König fort, der im Alter von 26 Jahren siegestrunken zum Rendezvous mit dem Ruhm aufgebrochen war, der mit der Okkupation Schlesiens winkte; er war den Deutschen vertraut als skeptischer Greis, der stets in demselben verschlissenen Uniformrock mit Dreispitz auftrat und seinen gebrechlichen Körper auf einen Stock stützte. Dieses bereits im 19. Jahrhundert durch literarische Werke, die reich illustriert waren, verbreitete Friedrich-Bild erlebte im Zeitalter des Kinos seine Renaissance auf der Leinwand. Kein Sujet war an den Kinokassen so erfolgreich wie der „Alte Fritz“: Hier wurde in einem Medienverbund aus Text, Illustration und bewegtem Bild ein visuelles Muster etabliert, an dem sich Hitler bei der Nachahmung Friedrichs orientierte. Dabei war der Umstand von kaum zu unterschätzender Bedeutung, dass in sämtlichen von 1922 bis 1942 gedrehten Kinofilmen der Preußenkönig durch ein und denselben Schauspieler dargestellt wurde: Otto Gebühr. Gebühr verschmolz so sehr mit dieser ihm auf den Leib zugeschnittenen Rolle, dass er als visueller Doppelgänger Friedrichs auch öffentlich in Erscheinung trat.
Der letzte große Kinofilm, der 1942 uraufgeführte Streifen Der große König, gab dabei den entscheidenden Maßstab ab. Goebbels persönlich nahm in einem vorher wie nachher nicht zu verzeichnenden Maß Einfluss auf die inhaltliche und visuelle Ausrichtung dieses Kassenschlagers. Präsentiert wurde ein von seinen Generalen im Stich gelassener Führerkönig, der in unbeirrbarer Strenge seinen Weg ging und einsame Führungsentscheidungen traf, die sich letztlich als richtig erwiesen. Das war ein Friedrich ganz nachdem Geschmack von Goebbels und Hitler. Dem „Führer“ gefiel die Darstellung der Hauptfigur so sehr, dass er Gebühr zum Staatsschauspieler ernannte und für die Publizität dieser Ernennung Sorge trug. Und er setzte durch, dass der Film den im Führerhauptquartier versammelten Spitzen von OKW und OKH als historisches Lehrbeispiel vorgeführt wurde, wobei die Kritik des Films an der Gefolgschaftstreue der Generale viele der anwesenden Militärs erzürnte. Hier war ein König am Werk, der seine Führungsentscheidungen nicht aus rationalem Kalkül ableitete, der sich gegen die professionellen Einwände seiner Generalität abschirmte und allein durch die Kraft seines Willensden Erfolg erzwang. Es war diese genialische Verbindung von Tatkraft und Eingebung, von Willensstärke und Inspiration, die aufmerksame Rezipienten wie den Literaten Karl Eugen Gass zu der Einschätzung kommen ließ, der Film habe „das geheime Künstlertum des Politikers“ offenbaren wollen.
Der Fridericus im Großen König gab das Muster vor, das den Besuchern des Führerhauptquartiers vor Augen stand, wenn sie Hitler gegenübertraten, so dass sie eine zunehmende Ähnlichkeit Hitlers mit dem ikonischen „Alten Fritz“ zu erkennen glaubten. Hitler, der auf seinen Wunsch hin eine Kopie des Films erhalten hatte, konnte sich jederzeit das Vorbild des revitalisierten Friedrich vorführen lassen. Diese alternde Herrscherfigur zeigte ihm eine perfekte Möglichkeit auf, seinen durch den Krieg enorm beschleunigten Alterungsprozess so zu präsentieren, dass sein Herrscherbild keine Kratzer erhielt. In der Öffentlichkeit konnte sich der Feldherr Hitler rar machen und seit 1943 sogar in visueller Hinsicht die Flucht ergreifen; aber als oberster Befehlshaber der Wehrmacht musste er im Führerhauptquartier jeden Tag die kritischen Blicke seiner militärischen Entourage über sich ergehen lassen. Das Feldherrngenie Hitler konnte sich auf den unsichtbaren Feldherrnolymp begeben; aber im militärischen Alltagsgeschäft konnte Hitler seinen Körper nicht verbergen. Wie konnte ein alterndes Genie damit umgehen?
Hitler sprach schon im Frühjahr 1942 ganz offen mit Goebbels darüber, dass seine körperliche Verfassung Schaden genommen habe. Damit thematisierte er einen Sachverhalt, über den keiner hinwegsehen konnte, der Hitler seit längerer Zeit kannte. Bereits vor dem Attentat, das den gesundheitlichen Verfallsprozess beschleunigte, konstatierte Goebbels mit Bezug auf Filmaufnahmen aus dem Jahr 1939: „Damals war er noch ein junger Mann, im Kriege ist er älter und älter geworden, und jetzt geht er schon ganz gebeugt.“ In seinen Tagebüchern und gegenüber Vertrauten nahm Goebbels kein Blatt vor dem Mund. Hitler war im Verlauf des Kriegs zu einem körperlichen Wrack geworden. „Jemand, der ihn zwei oder drei Jahre lang nicht gesehen hat, würde entsetzt sein, ihn heute wieder zu treffen. Nicht nur, daß er körperlich erschreckend gealtert und verfallen ist, daß er einen gebückten Rücken wie ein Greis hat, daß er mühsam und zittrig geht, daß ihm die Hände flattern, selbst wenn er sie in den Rocktaschen vergraben hat.“ Ein Generalstabsoffizier, der Hitler im März 1945 nach vielen Jahren wiedersah, war von seinen Kameraden vorgewarnt worden – doch die Wirklichkeit übertraf seine Befürchtungen: Der ihm von früher bekannte Hitler „war in nichts mit dem Wrack eines Menschen zu vergleichen, bei dem ich mich am 25.3.1945 meldete und der mir müde eine kraftlose, zitternde Hand entgegenstreckte“. Aus medizinhistorischer Sicht drängt sich der Eindruck auf, dass diese Schüttelsymptome darauf zurückzuführen waren, dass Hitler an der Parkinson-Krankheit litt.
Der große König machte Hitler vor, dass alters- und krankheitsbedingte Einschränkungen keine Limitierung des Genieanspruchs bedeuteten – im Gegenteil. Hitler zog daraus den Schluss, dass man „von einem alternden Genie verlangen muß, daß es sich den Forderungen des Alters nicht entgegenstemmt“. Den offensiven Umgang mit körperlichen Verfallserscheinungen konnte Hitler wagen, wenn ihm dabei die Imitation des ikonischen „Alten Fritz“ glückte. Und so hat Hitler – natürlich nur im kleinen Kreis und gegenüber seinen engsten Gefolgsleuten – aus seinem körperlichen Verfall noch politischen Nutzen gezogen, indem er auch körperlich die Nachfolge Friedrichs beanspruchte. So hat er vor den Gau- und Reichsleitern, als diese ihn am 5. August 1944 erstmals nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 zu Gesicht bekamen, für seinen körperlichen Niedergang nicht die Folgen des Attentats (zerplatzte Trommelfelle) angeführt, sondern die Querelen mit der Generalstabsclique, welche hinter dem Attentat gestanden habe. Er sei alt und zittrig geworden nicht durch den Kampf mit den äußeren Feinden, sondern durch die unablässige Auseinandersetzung „mit dieser Clique, die nie zu fassen war“. Wie Friedrich der Große seine Gesundheit im ständigen Kampf mit renitenten Generalen ruiniert habe, so habe er sich darin verzehrt, gegen Unbotmäßigkeiten und Sabotageversuche seiner militärischen Ratgeber anzugehen.
Bei seinem letzten Auftritt vor den Gau- und Reichsleitern, am 25. Februar 1945, trieb er die Analogie mit Friedrich auf die Spitze. Hitler wusste, dass er ein gesundheitliches Wrack war und dass der Eindruck seiner Ausführungen durch das ständige Zittern seines linken Arms beeinträchtigt wurde. Aber die visuelle Vorlage des „Alten Fritz“ gestattete es ihm, die verunsicherten Gauleiter wieder einzufangen, indem er seinen Gesundheitszustand von sich aus zur Sprache brachte: „Wie Sie sehen, befinde ich mich zur Zeit nicht in bester gesundheitlicher Verfassung. Mein linker Arm zittert … Jetzt erst verstehe ich so recht Friedrich den Großen, der nach Beendigung seiner Feldzüge als ein kranker, gebrechlicher Mann nach Hause kam … So wie Friedrich der Große mit gebeugtem Oberkörper und geplagt von Gicht und allen möglichen anderen Leiden seine letzten Jahre verlebt hat, so hat auch bei mir der Krieg seine tiefen Spuren hinterlassen.“ Bislang hatte Hitlers Stimme die sinnliche Bürgschaft für die von ihm verkündeten politischen Botschaften übernommen; im letzten Kriegsjahr war es der von Krankheit gezeichnete, derangierte Körper, der als authentische Beglaubigung eingesetzt werden konnte, weil Friedrich der Große als Vorlage zur Verfügung stand.
Einigen Beobachtern fiel unabhängig voneinander auf, wie sehr sich Hitler als körperliches Gesamtkunstwerk dem „Alten Fritz“ angenähert hatte. Als der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe A, Generalfeldmarschall Ewald von Kleist, Hitler nach längerer Pause im Februar 1943 wiedersah, hielt er in seinem Tagebuch fest: Hitler „ist gealtert – erinnert unwillkürlich in seiner Haltung und Gebärden an den alten Friedrich den Großen“. Dessen Bild war gemäß der filmischen Vorlage Der große König nicht das des Siegers von Roßbach und Leuthen, sondern das eines Feldherrn, der gerade bei Kunersdorf eine schwere Niederlage erlitten hatte und von seiner Generalität im Stich gelassen zu werden drohte. So ließ sich eine Parallele zum Attentat vom 20. Juli 1944 ziehen, nach dem sich Hitler wie einst Friedrich auf einen Stock stützte und das Kinn auf fritzische Weise vorstreckte. Solche körperlichen Angleichungen waren verbunden mit einer Lebensführung, bei der sich Analogien zum „Alten Fritz“ geradezu aufdrängten. Hitler war nie ein Genussmensch gewesen, der sich den Freuden des Lebens hingab. Er begnügte sich mit vegetarischer Kost, trank praktisch keinen Alkohol, verzichtete auf Nikotin, und dass seine Begleiterin Eva Braun nie ins Führerhauptquartier kam, zeugte nicht von einer stark ausgeprägten Libido. Gregor Strasser, der wichtigste Parteiorganisator der NSDAP vor 1933, hatte schon 1930 mit einem gewissen Kopfschütteln konstatiert: Hitler „ist nur Genie und Körper. Und diesen Körper kasteit er, daß es unsereinen jammern kann! Er raucht nicht, er trinkt nicht, er ißt fast nur Grünzeug, er faßt keine Frau an!“
Wie der Preußenkönig Friedrich trug Hitler seit Beginn des Krieges stets nur einen einfachen Uniformrock. Er stolzierte niemals in Gala-Uniform herum wie der prunksüchtige Göring und zeigte sich überhaupt nicht mehr in Zivilkleidung, immer nur in schlichter militärischer Arbeitskluft ohne jeglichen Ordensschmuck bis auf das Eiserne Kreuz. Hitler kalkulierte ein, dass Kleider Leute machen. Mit seiner strikten Absage an eine modische Garderobe zog er sich gelegentlich das Missfallen von Eva Braun zu, die sich gerne modisch kleidete: „Du mußt dem ›Alten Fritz‹ nicht alles nachmachen und auch so unappetitlich herumlaufen wie er.“ Hitler verbrachte den größten Teil seiner letzten vier Lebensjahre in seinen Führerhauptquartieren, mithin in einer rein militärischen Umgebung, die in ihrer Abgeschiedenheit und Selbstbezogenheit an die Feldlageratmosphäre erinnern konnte, die der roiconnétable so liebte. Auch Hitlers Kinderlosigkeit passte zum Vorbild Friedrich, der nur eine Scheinehe geführt hatte. Das einzige Lebewesen, das seit Frühjahr 1942 im Führerhauptquartier ständig um ihn herum war und auch nachts nicht von seiner Seite wich, war seine Schäferhündin „Blondi“. Aus Zuneigung zu diesem Tier war der Nachtmensch Hitler sogar zum Schlafverzicht bereit, wenn er sich gegen 9 Uhr morgens nach kurzer Nachtruhe von seinem Liebling wecken ließ; dieser „stürze sich auf ihn und mache ihm durch kräftiges Schlagen mit den Pfoten die wildesten Liebeserklärungen“. Auch hier drängten sich Parallelen zu Friedrich auf, der tiefere Neigungen eigentlich nur seinen Windspielen entgegenbrachte, neben denen er bestattet werden wollte.
Auch beim Abgang aus der Geschichte bot Friedrich der Große Hitler Orientierung. Ein abschreckendes Beispiel stellte dagegen Wilhelm II. dar, der nicht nur aus Hitlers Sicht sein letztes noch vorhandenes Ansehen – und das seiner Dynastie – durch einen unwürdigen Abschied verspielt hatte, indem er sich nach der Niederlage ins neutrale Ausland absetzte. Dass der Nachfahre Friedrichs des Großen die Flucht ergriff, um sein nacktes Leben zu retten, setzte seiner unsoldatischen Disposition gewissermaßen die Krone auf: Der oberste Befehlshaber der deutschen Streitkräfte im Weltkrieg handelte nicht gemäß dem militärischen Ehrenkodex. Für Hitler war Wilhelm II. ein „charakterloser Schwächling“, der nur martialische Reden hielt, aber nicht zu kühnen Taten entschlossen war; „großsprecherisch und doch feige in jedem Entschluß“. Im Unterschied zu Wilhelm II., den gerade seine wenig militärische Ader davon abhielt, bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs als Kriegstreiber zu wirken, hatte der Kriegstreiber Hitler seit Beginn des von ihm entfesselten Krieges eine klare Vorstellung davon, was im Falle einer militärischen Niederlage mit dem obersten Befehlshaber der Wehrmacht geschehen solle. Kurz nach dem ersten von deutschen Truppen abgegebenen Schuss, also schon am 1. September 1939, legte er sich vor der Weltöffentlichkeit fest, wie er mit dem Makel einer Niederlage umgehen werde: „Ich werde dieses Ende nicht erleben!“ Dass er scheitern könnte, gehörte zu seinem Selbstentwurf als Genie der Tat, das auf mächtige Gegenspieler angewiesen war und sich freiwillig in eine politische Gefahrenzone begab, in der ein Scheitern nicht ausgeschlossen war.
Hitler eiferte auch damit – ob bewusst oder unbewusst – Friedrich dem Großen nach. Denn dieser hatte ebenfalls zu verstehen gegeben, dass er freiwillig aus dem Leben scheiden werde, wenn Preußen die Waffen strecken müsse. Nach der verheerenden Niederlage von Kunersdorf im August 1759 spielte er erstmals mit dieser Möglichkeit und tat das sogar schriftlich kund. Im Januar 1762 war Preußen militärisch an einem Tiefpunkt angelangt und politisch isoliert, da Großbritannien im Begriff war, das lebenswichtige Militärbündnis mit Preußen aufzukündigen. Friedrich II. konnte nicht wissen, dass just zu dem Zeitpunkt, als er Selbstmordabsichten äußerte, die russische Zarin bereits gestorben war und sich die Rettung Preußens aus der schier aussichtslosen Lage anbahnte. Hitler war diese Begebenheit vertraut, da sie im wirkungsmächtigen Werk Carlyles ausführlich geschildert wurde. Als Goebbels Hitler Ende Februar 1945 den wesentlichen Inhalt des Carlyle-Buches nahebringen wollte mit der Begründung: „Wir müssen so sein, wie Friedrich der Große gewesen ist, und uns auch so benehmen“, musste er feststellen, dass Hitler dieses „Buch sehr genau“ kannte. So hatte Hitler erst drei Wochen zuvor – vermutlich unter Rekurs auf einschlägige Stellen Carlyles – in seiner nächtlichen Gesprächsrunde ausgeführt, dass Friedrich der Große die feste Absicht verfolgt habe, aus dem Leben zu scheiden, wenn das Kriegsglück sich nicht zu seinen Gunsten wende.
Friedrich schloss für sich die klassische Möglichkeit aus, die einem geschlagenen Feldherrn zur Verfügung stand: den Tod an der Front zu suchen, indem er mit der Waffe in der Hand dem Feind entgegentrat und sein Leben in einem letzten Gefecht auf soldatische Weise aushauchte. Eine solche soldatische Selbstaufopferung hatten einige ultramonarchistische Offiziere im November 1918 dem Kaiser nahezubringen versucht, weil sie um den hohen Symbolgehalt eines solchen Opfergangs wussten: Der geschlagene Feldherr trat würdevoll ab, indem er wie seine tapferen Soldaten sein Leben als Opfer für Höheres hingab. Da Hitler mit kaum zu überbietender Rücksichtslosigkeit das Leben jedes männlichen Deutschen für seinen Krieg verpfändet hatte und nicht die geringsten Skrupel hegte, als letztes Aufgebot selbst Schuljungen zu verheizen, hätte der Einsatz seines Lebens in einer militärisch sinnlosen Aktion nahegelegen. Er wäre damit all denen nachgefolgt, die er auf dem Altar seiner menschenverachtenden Ideologie geopfert hatte.
Hitler boten sich durchaus Gelegenheiten für einen solchen Abgang. Nachdem er in der Lagebesprechung vom 22. April 1945 den Krieg erstmals als verloren erklärt hatte, schlug er die Möglichkeit aus, sich nach Süddeutschland abzusetzen, sondern entschied, als Kommandant die Festung Berlin bis zur letzten Patrone zu verteidigen. Damit blieb er seinem dogmatischen Denken in Festungskategorien treu und wahrte zumindest potentiell die Chance zu einem geschichtsmächtigen Abtritt: Der oberste Befehlshaber der Wehrmacht kapitulierte nicht kampflos, sondern fiel in den Trümmern der Reichshauptstadt im Kampf gegen seinen vermeintlichen Hauptfeind, den sowjetischen Bolschewismus. Hitler hat allem Anschein nach ein solches Fanal ernsthaft erwogen. Bereits im Spätherbst 1944 gab es Indizien, dass Hitler mit der Idee liebäugelte, die „Wolfsschanze“ als Festung zu deklarieren und dort das Schicksal eines Festungskommandanten zu suchen. Im Frühjahr 1945 war es die Festung Berlin, in der Hitler seine Festungsdoktrin mit seinem Leben einlösen konnte: Es sei „kein schlechter Abschluß eines Lebens, wenn man im Kampf für die Reichshauptstadt fällt“, erklärte er auf einer seiner letzten Lagebesprechungen, verwarf den Gedanken dann aber rasch. Denn körperlich war er längst nicht mehr imstande, mit der Waffe in der Hand dem Feind so entgegenzutreten, dass sein Tod im Gefecht gewiss war. Und damit drohte etwas, was Hitler in jedem Fall vermeiden wollte, nämlich verwundet in die Hände der Roten Armee zu fallen. Damit wäre er zum Spielball Stalins geworden, zu einer Art Trophäe, deren Verwertung ganz im Belieben des Siegers lag. Selbst wenn er vor Gericht gestellt worden wäre, hätte er – anders als beim Hitler-Prozess des Jahres 1924 – den Gerichtssaal nicht zur Selbstdarstellung nutzen können.
Es gab für Hitler mithin keine Möglichkeit mehr, performativ noch einmal in Erscheinung zu treten und sich mit einem rednerischen Auftritt aus der Geschichte zu verabschieden. Er konnte seinen Tod nicht als heroischen Abgang inszenieren; und so starb er nicht den Soldatentod, den er von jedem anderen Festungskommandanten erwartete. Sein Nachfolger als oberster Befehlshaber der Wehrmacht, Großadmiral Dönitz, hat Hitler nachträglich einen solchen „Heldentod“ verschaffen wollen, als er in seiner öffentlichen Proklamation an Volk und Wehrmacht einen Tag nach dem Selbstmord Hitlers eine verfälschte Version von dessen Ableben in Umlauf brachte. Dem deutschen Volk sollte vorenthalten werden, dass Hitler sich durch schnöden Selbstmord der Verantwortung für sein Tun entzogen hatte. Dönitz führte über den Rundfunk aus: „Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen … Frühzeitig hatte er die furchtbare Gefahr des Bolschewismus erkannt und diesem Ringen sein Dasein geweiht. Am Ende dieses seines Kampfes und seines unbeirrbaren geraden Lebensweges steht sein Heldentod in der Hauptstadt des deutschen Reiches.“ Damit gab er die offizielle Sprachregelung vor, welcher der Reichssender Hamburg folgte, als er am 1. Mai 1945 die Nachricht verbreitete, Hitler sei „in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei, bis zum letzten Atemzug gegen den Bolschewismus kämpfend, für Deutschland gefallen“.
Dönitz wollte damit dem unrühmlichen Ende Hitlers eine Deutung verleihen, die auch bei nicht eingefleischten Nationalsozialisten Anklang finden konnte. Wenn er die politische Vita Hitlers als antibolschewistische Mission darstellte, hielt er an jenem Element des Nationalsozialismus fest, das bei nicht wenigen Deutschen auf Zustimmung stieß und auch für die Zeit nach Hitler anschlussfähig schien. Allerdings war dies eine eigenmächtige Inanspruchnahme des toten Hitler: Denn dieser hatte kurz vor seinem Tod ein auch Dönitz überstelltes politisches Testament hinterlassen, in dem er mit keinem einzigen Wort auf diese vermeintliche antikommunistische Lebensaufgabe einging. Hitlers ideologische Antriebskraft war nicht der Kampf gegen den Sowjetkommunismus, weil ihn seine Erfahrung mit der Sowjetunion Stalins im Verlaufe des Krieges zu der Einschätzung geführt hatte, dass das „Judentum“ kein essentieller Bestandteil dieser Herrschaft sei. Vier Wochen vor seinem Selbstmord sah er das dortige System sogar auf dem Weg, sich weltanschaulich vom Erbe des „Juden“ Marx völlig zu befreien und damit allein auf die Karte von Nationalismus und Panslawismus zu setzen – weltanschauliche Triebkräfte, die Hitler als ehemaligem Angehörigen der k.u.k-Monarchie aus der Politik des zarischen Russland vertraut waren. „Die Russen sind fähig, sich unter dem Druck der Verhältnisse einmal völlig vom jüdischen Marxismus zu lösen, um nur noch dem unvergänglichen Panslawismus in seiner grausamsten und wildesten Entartung zu leben.“ Damit war aus Hitlers Sicht eine Übereinkunft mit der Sowjetunion möglich. Hitlers letzter Generalstabschef Krebs hat daher nach Hitlers Ableben einen letzten Versuch unternommen, mit der sowjetischen Seite in Verhandlungen einzutreten.
Die ideologische Kernbotschaft Hitlers von seinen politischen Anfängen im Herbst 1919 bis zu seinem Untergang im April 1945 war allein sein fanatischer Antisemitismus. Und so endet denn auch der letzte Satz in seinem politischen Testament mit einem Appell „zum unbarmherzigen Widerstand gegen den Weltvergifter aller Völker, das internationale Judentum“. Da das „Weltjudentum“ seinen Einfluss über die kapitalistische Wirtschaftsordnung ausübe, wobei die Völker letztlich nichts „als Aktienpakete dieser internationalen Geld- und Finanzverschwörer“ seien, war es nicht verwunderlich, dass in seinem politischen Vermächtnis mit keinem Wort von der Sowjetunion, wohl aber von Großbritannien und den USA als Hauptbetätigungsfeldern der jüdischen Wirtschaftsinternationale die Rede war. Damit bekräftigte Hitler das, was er Anfang April 1945 im vertrauten Kreis geäußert hatte: Der „verjudete Amerikanismus“ sei nicht imstande, sich vom „Joch der New Yorker Juden“ zu lösen; und damit könnten die USA auch nicht zu einer Weltmacht werden und Sowjetrussland die Stirn bieten.
Hitlers Entschluss zum Selbstmord entsprang nicht nur der Furcht, als Siegesbeute in die Hände der Roten Armee zu fallen. Er wollte auch verhindern, dass sein toter Körper in die Verfügungsgewalt seiner Widersacher geriet. Schon beizeiten hatte er verfügt, wie mit seiner Leiche zu verfahren sei. Angesichts der äußeren Umstände war an ein Mausoleum in seiner Heimatstadt Linz nicht zu denken; aber auch die Bestattung nach Soldatenart verwarf er mit dem Entschluss zum Selbstmord. Dass sein toter Leib nicht zum Gegenstand einer performativ gestalteten Begräbnisfeier wurde, hat Hitler leicht verwinden können, weil sein großes Vorbild ebenfalls keinen Wert auf eine feierliche Bestattung gelegt hatte. Friedrich der Große wollte ohne jeden höfischen Pomp und vor allem ohne kirchliche Begleitung in aller Stille auf der Terrasse von Sanssouci bestattet werden. Daher wäre ein Verscharren der Leiche Hitlers durchaus mit der Auffassung Friedrichs von der Rückkehr des Leibes zu den Elementen der Natur vereinbar gewesen. Aber Hitler musste einkalkulieren, dass die Rote Armee sich auf die Suche nach seinem der Erde übergebenen Leichnam machen könnte; und wenn sie ihn fand, würde dieser schutzlos der Willkür der neuen Herren Berlins ausgeliefert sein. Hitler hielt es für denkbar, dass man mit ihm ähnlich wie mit Lenin verfahren könnte – seine Leiche also einbalsamiert und wie in einem Panoptikum in Moskau ausgestellt würde. Daher verpflichtete er seinen persönlichen Adjutanten Otto Günsche schriftlich zur Verbrennung seiner sterblichen Überreste. Das Ende seines einzigen wirklichen politischen Freundes, des ihm wesensverwandten Benito Mussolini, dessen Leichnam nach der Tötung durch Partisanen im Mailand zur Schau gestellt und dem Volkszorn ausgeliefert worden war, hat Hitler darin bestärkt, im privaten Teil seines Testaments zu verfügen, dass seine sterblichen Überreste sofort im Garten der Reichskanzlei zu verbrennen seien.
Der Körper Hitlers löste sich damit in Asche auf; was von Hitler blieb und was er als sein Vermächtnis ansah, war ein Schriftstück – sein in der Nacht vom 28. auf den 29. April 1945 diktiertes politisches Testament. Hitler wollte sich mit seinem politischen Testament als Politiker wie als Feldherr einen Abgang im Modus der Schriftkultur verschaffen. Denn der Text war im Unterschied zum performativen Auftritt auf dauerhafte Wirkung angelegt; sein Sinn sollte sich auch den Nachgeborenen auf diskursive Weise erschließen. Insofern steht am Anfang und am Ende des politischen Auftrittskünstlers Hitler ausgerechnet ein Text: 1925 meldete er sich mit Mein Kampf zum ersten Mal mit einer zusammenhängenden politischen Botschaft zu Wort; und 1945 wollte er der Nachwelt das in schriftlicher Form hinterlassen, was er von seiner ursprünglichen Botschaft als zukunftsfähig einstufte.
Bis zur bedingungslosen Kapitulation der deutschen Streitkräfte am 8. Mai 1945 sind noch Tausende von Soldaten in einem militärisch längst sinnlos gewordenen Kampf geopfert worden. Im Jahr 1945 starben mehr deutsche Soldaten als in allen anderen Kriegsjahren, obgleich der Krieg in diesem Jahr kaum mehr als vier Monate dauerte. Hitlers Selbstmord animierte fanatische Nationalsozialisten wie auch militärische Funktionsträger dazu, sich ebenfalls das Leben zu nehmen. Von den Getreuen, die bis zum Schluss mit Hitler im Bunker ausgeharrt hatten, wählten alle vier Zeugen des politischen Testaments diesen Weg – und Goebbels und seine Ehefrau nahmen auch noch ihre sechs Kinder mit in den Tod. Walther Hewel erschoss sich, als der Ausbruchsversuch aus der Reichskanzlei fehlschlug. Die offiziell verbreitete Version, dass Hitler in seinem Befehlsstand kämpfend gefallen sei, war ein Signal an Hitler-Getreue, die nicht in Berlin anwesend waren, es dem „Führer“ noch nach der Kapitulation gleichzutun. Der letzte Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Ritter von Greim, hatte Hitler Ende April 1945 im bereits eingeschlossenen Berlin aufgesucht, begleitet von der tollkühnen Fliegerin Hanna Reitsch. Beide verehrten den Ort, an dem Hitler „gefallen“ war, als „Altar des Vaterlandes“. Greim vergiftete sich am 24. Mai 1945, nachdem er bereits Wochen zuvor seinen Selbstmord angekündigt hatte; und die Familie von Hanna Reitsch wählte ebenfalls den Freitod.
Hitlers politisches Testament blieb unerfüllt – auch weil die Deutschen bei ihrem zweiten Versuch der demokratischen Selbstbestimmung ein gesundes Misstrauen gegen jede Form von ästhetischer Überladung der Politik entwickelten. Konrad Adenauer bildete nicht nur in dieser Hinsicht den Gegenpol zu Adolf Hitler. Hitlers genialisch überhöhte Herrschaft offenbart wie kein zweites Beispiel der Weltgeschichte die zerstörerischen Potenzen einer Auslieferung der Politik an einen Künstler-Politiker. Einem zum Genie erhobenen „Führer“ wurde die Selbstermächtigung zuerkannt, alles zu tun und zu lassen, was ihm beliebte; das deutsche Volk lieferte sich auf Gedeih und Verderb einer omnipotenten Herrschaftsform aus. Herrschaftstypologisch repräsentiert Hitler die weltgeschichtlich eher rare Variante einer charismatischen Herrschaft, bei der Charismaverlust durch die Mobilisierung eines Geniekults kompensiert werden konnte. So blieb selbst ein Hitler, der kommunikative Abstinenz praktizierte und eine Kette militärischer Niederlagen zu verantworten hatte, bis in seine letzten Monate ein Herrscher, der auf umfassende Gefolgschaftstreue bauen konnte.
|
||