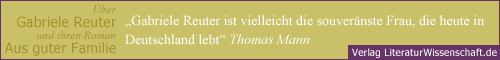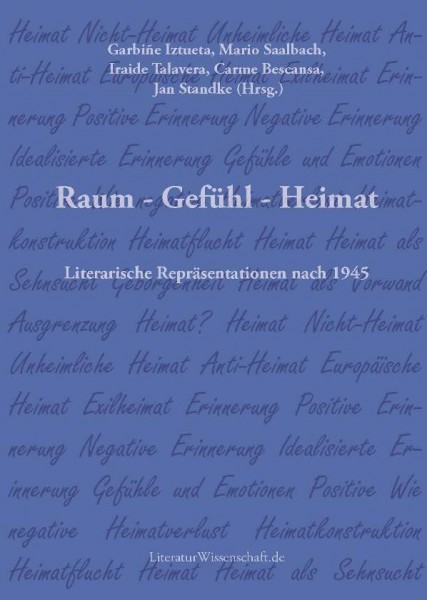Homo exculpator
Fritz Breithaupt macht in „Kultur der Ausrede“ einen marginalen Sprechakt zum Angelpunkt der Kulturgeschichte
Von Willi Huntemann
Unlängst hat der Literaturwissenschaftler Heinz Schlaffer in seiner viel beachteten Schrift „Geistersprache“ eine Gattung von einer an ihrem Anfang stehenden kulturellen Praktik beleuchtet: ohne die in ihr nachwirkende archaische Götteranrufung sei auch moderne Lyrik nicht zu verstehen. In eigenartiger Parallelität und auf nicht viel mehr Seiten als Schlaffer versucht nun der in Bloomington / USA wirkende Literatur- und Kognitionswissenschaftler Fritz Breithaupt nicht eine Gattung, sondern fundamentale Schlüsselpraktiken und -konzepte unserer Kultur wie Erzählen, Verantwortung, Gewissen sowie Ich aus dem Redemodus der Ausrede herzuleiten – oder zumindest neu zu beleuchten, dies sowohl genetisch wie strukturell.
Im Vergleich mit diesem Wurf nimmt sich der Schlaffer’sche Traktat geradezu bescheiden und kleinlaut aus. Auch Breithaupt rekurriert auf eine Urszene: die adamitische Ausrede im Sündenfallmythos der Bibel, und knüpft daran die gewagte kulturanthropologische These: „Ausreden […] stellen nicht nur eine der vielen Formen von Erzählungen dar, sondern zeigen die Struktur aller Narrationen in Reinform, Erzählen heißt Ausreden erfinden“. Davon abgeleitet sollen dann auch alle narrativ konstituierten Konzepte wie Verantwortung oder Ich in der Ausrede gründen. (Hieran sieht man schon, dass es sich keineswegs um eine „Kulturgeschichte“ handelt, etwa nach dem Muster einer „Kulturgeschichte der Lüge“.)
Diese These will vorderhand in keiner Weise einleuchten; sie tut es – dies sei vorweggenommen – auch nach aller beträchtlichen argumentativen Zurüstung des Verfassers nicht. Wie sollte etwas so Allgemeines und Vielgestaltiges wie Erzählen in etwas so Partikular-Kontextgebundenem wie Ausreden gründen? Die als paradigmatisch hingestellte adamitische Ausrede täuscht darüber hinweg, dass Sich-Herausreden ein diskursiver, kein notwendig narrativer Sprechakt ist. Einfachste Alltagsbeispiele machen das klar. Auf die Frage nach seiner Verspätung antwortet jemand: „Der Bus stand im Stau“ – mit dieser Ursachennennung ist die Ausrede fertig. Er kann freilich sagen: „Ich habe verschlafen, habe dann den Schlüssel nicht gefunden und dann stand auch noch der Bus im Stau“, was als minimaler Erzählzusammenhang daherkommt, doch er erzählt nichts im strikten Sinne, sondern liefert nur drei Gründe. Sich-Herausreden ist immer Ich-Rede; allenfalls Ich-Erzählungen hätten somit eine Affinität zur Ausrede. Sie evolutionär zum Prototyp von Erzählen zu machen, wäre zumindest recht spekulativ, zumal archaisch-mythische Narration (Kosmogonien etwa) nicht aus dem Erlebnisbericht abzuleiten ist. Erzählen müsste vor allem wesentlich dialogisch sein oder, wenn nicht in einem Kontext von Vorwurf und Anklage, so doch zumindest in einem dialogischen Kontext stehen. Wäre dem aber so, wäre es eher dramatischer Rede ähnlich. Wie sollte also Erzählen strukturell der Ausrede verwandt sein, wenn schon die Ausrede nicht notwendig narrativ konstituiert ist?
Nun greift Breithaupt zu einer Hilfskonstruktion, um seine These plausibel zu machen. Ihm geht es nicht um den Täuschungsaspekt der Ausrede und schon gar nicht um die moralische Bewertung, sondern um eine alternative Version eines Sachverhalts, die der Anklage gegenübersteht und die scheinbar eindeutige Faktizität verunsichert. Dieser Gedanke ist das logische Scharnier, welches die Affinität von Sich-Herausreden und Erzählen plausibel machen soll: 1. Die Ausrede bietet eine andere Version des behaupteten Sachverhalts und fordert Interpretation ein. 2. Erzählen ist immer Anders-Erzählen und daher interpretationsbedürftig. 3. Conclusio: Erzählen ist der Ausrede strukturverwandt. Dieser (hier vereinfacht wiedergegebene) Schluss ist fehlerhaft, wie man leicht sieht – er ist aber der archimedische Punkt der gesamten Argumentation des Buches.
Nun muss die „Vielversionalität“ intrinsisch im Erzählen verankert werden, da dieses eben nicht dialogisch auf eine vorgängige Behauptung reagiert. Es ist die in die Zukunft gerichtete „potenzielle Vielversionalität“ im Kopf des Lesers oder Hörers, für den im Handlungsgang zunächst alles möglich ist, die Spannung konstituiert oder aber die retrospektive, die etwa der Novelle des 19. Jahrhunderts ihren Reiz verleiht. Die Mehrdeutigkeit als altbekanntes Merkmal literarischer Rede ist damit nicht weit. Sie verträgt sich schlecht mit dem vorliterarischen und vormodernen Erzählen, an dem der Verfasser zunächst seine Argumentation entwickelt. Breithaupt beruft sich hier zu unrecht auf Walter Benjamin mit seinem „Erzähler“-Aufsatz. Benjamin ging es nicht um den Aspekt des „Es könnte auch anders sein“, sondern für ihn ist das prototypische Erzählen das vormoderne mündliche Erzählen der Bauern, Handwerke und Seeleute, in dem Weisheit und Erfahrung weitergegeben werden und das er in einer kulturkritischen Verfallsgeschichte gegen den Roman der Neuzeit und das Informationszeitalter abhebt. Nicht Anklage und strategische Klugheit, sondern Erfahrung und Weisheit sind für Benjamin die kulturellen Wurzeln des Erzählens. Breithaupts kulturanthropologischer Ansatz kann diesem Wandel des Erzählens in der Kulturgeschichte nicht Rechnung tragen.
Nun schließt der Verfasser in seinem der fiktionalen Literatur gewidmeten Kapitel – es ist eines der schmalsten – hier auch gar nicht an, sondern verdünnt den Fundierungszusammenhang nochmals. Nun sollen Handlungen in Erzählungen als „Reaktionen auf frühere Kräfte“ strukturell der Ausrede verwandt sein. Der geschichtliche Aufriss vom Epos über die Tragödie bis zur modernen Novelle ist zu knapp, um über altbekannte rezeptionsästhetische Einsichten hinauszuführen. Dass der Verfasser sich immerhin vom noch abstruseren Versuch Paul de Mans absetzt, Fiktion aus der Ausrede herzuleiten, tröstet ein wenig über die wenig originelle Einsicht dieses Kapitels: „Dies ist das Wesensmerkmal von Fiktion, dass alles mit allem verknüpft und verkettet wird“.
Was Breithaupt aber – bei aller Informiertheit in den aktuellsten Theoriediskursen – mit Benjamin gemein hat, ist eine offenbar unausrottbare Denkfigur, die auch das Denken Martin Heideggers (nicht allein in seinem Etymologisieren) maßgeblich bestimmt. Es ist die Vorstellung, dass im Ursprung einer Sache zugleich ihr „Wesen“ beschlossen liege, dass – bezogen auf Sprache – die ursprüngliche Bedeutung eines Wortes die „eigentliche“ sei, jeder Wandel immer der Verfall eines authentischen Urzustands sei (kulturkritisch: das Goldene Zeitalter). Erzählen und Verantwortung müssen der Suggestion dieses Denkmusters zufolge schon deswegen – wie auch immer – der Ausrede verwandt sein, da die erste überlieferte menschliche Rede als Urszene ein Ausrede- und Verantwortungs-Fall war.
Doch Breithaupt will nicht nur hoch hinaus, sondern vor allem weit zurück – noch hinter den biblischen Sündenfall. Im zweitlängsten (und zu lang geratenen) Kapitel seiner Schrift stellt er „evolutionsbiologische Überlegungen zu Täuschung und Ausrede“ an – quasi eine Option für Darwinisten, denen der biblische Paradiesmythos ein zu unsicherer Grund für eine kulturanthropologische Hypothese ist. Es geht freilich um nichts Geringeres als den Ursprung des Erzählens. Für Breithaupt sind es nicht Mythos, Klatsch oder Stärkung der Gruppenmoral, die die Entstehung des Narrationsvermögens begünstigt haben, sondern Ablenkungsverhalten unter Mantelpavianen und ihre Deutung, um handeln zu können. Dies sei eine vorsprachliche „Protonarration“, die als Typus der adamitischen Ausrede noch vorausliege. Der Kognitionswissenschaftler Breithaupt referiert hierbei in ermüdender Breite die einschlägigen Studien der Primatenforschung.
Das zweite Kernkapitel widmet sich der „Genese von Verantwortung“. Wieder im Anschluss an eine biblische Urszene, der Geschichte von Jona und dem Wal, versucht Breithaupt, das Moralempfinden im Rede-und-Antwort-Stehen zu fundieren; das gemeinhin als Epiphänomen Betrachtete wird zum Kern. Dafür wird das Gewissen bestimmt als „Wiederholung des Dialogs von Anklage und Entgegnung“ – ein „schlechtes Gewissen“ zeigt letztlich Mangel an guten Ausreden an, die einen entlasten könnten. Diese Idee ist zumindest diskutierenswert, da laut Verfasser mit dieser moraltheoretischen Konstruktion auf sprachpragmatischer Basis keineswegs die Ethik ersetzt werden soll. Sie kommt dem nahe, was im Feld der Wahrheitstheorien die Konsenstheorie darstellt: So wie dort nicht die Referenz auf außersprachliche Wirklichkeit Wahrheit begründet, ist hier nicht mehr die ontologische Unterscheidung von Gut und Böse Fundament des Moralempfindens. Der lange schon aus dem Fokus der Moraltheorie geratene Gewissensbegriff findet hiermit eine adäquate Neuformulierung. Eine Verlängerung findet diese Rekonstruktion noch in einem ausgedehnten rechtsgeschichtlichen Exkurs zum „schuldigen Bewusstsein“ (mens rea).
Wenn Breithaupt schließlich auch noch das moderne Ich und seine historische Konstitution von der Ausrede-Narration zu begreifen sucht, betritt er alles andere als Neuland. Wilhelm Schapps phänomenologische Studie „In Geschichten verstrickt“ von 1953 zum Zusammenhang von Ich-Identität und Narrativität wäre hier als Anknüpfungspunkt wohl einschlägig – dem Verfasser, dem die Kognitions- und Primatenforschung offenbar näher stehen, scheint sie unbekannt zu sein.
Zugute zu halten ist Breithaupt, dass seine kühne These und ihre Ableitungen auf die verschiedenen Großbegriffe hin angesichts all der Vielfalt der disziplinären Perspektiven und Diskurse – von der Evolutionsbiologie über Kognitionsforschung zur Rechtsgeschichte –, den Exkursen und den oft überfrachteten Fußnoten erstaunlich klar bleibt und seine imposante theoretische Fantasie nie mit ihm durchgeht und auf den Darstellungsstil durchschlägt. Der Verfasser verbindet – in kulturtheoretischen Arbeiten keineswegs der Regelfall – angloamerikanische Klarheit mit teutonischer Gründlichkeit in der methodischen Reflektiertheit und bleibt in der minutiösen Entfaltung von Begriffen und Gedankenschritten stets dem Leser zugewandt. Doch in der Klarheit liegt auch die Angreifbarkeit, was Breithaupt bewusst ist, wenn er sein Verfahren nicht ohne eine gewisse Chuzpe als das „Bauen einer auf dem Kopf stehenden Pyramide“ beschreibt: „Je fester die Spitze oder je dreister der Baumeister ist, desto höher kann die umgedrehte Pyramide gebaut werden und sich oben ins Weite verlieren“ – sie kann aber auch einfach umkippen, wenn die Spitze der Belastung nicht standhält.
|
||