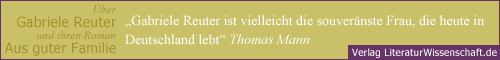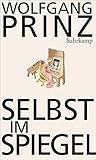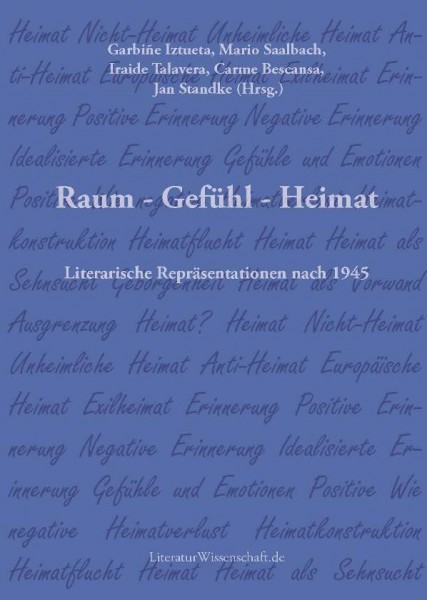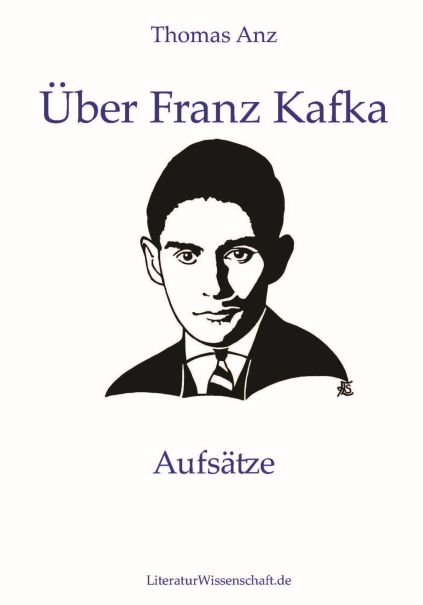Veraltete Spiegelfechterei
Zu Wolfgang Prinz’ Studie „Selbst im Spiegel. Die soziale Konstruktion von Subjektivität“
Von Roman Halfmann
„Was ist“, stellt der emeritierte Direktor am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaft in der zweiten Hälfte des vorliegenden Werkes die alles entscheidende Frage, „wirklich dran an unserer Wahrnehmung, daß wir ein Selbst sind bzw. haben?“
Eine sicherlich berechtigte, wenn auch nicht unbedingt neue Problemstellung, denn dass wir alle uns als Selbst bezeichnen und mit der Grundierung eines solchen Selbst durchs Leben wandeln, scheint unzweifelhaft, wissenschaftlich jedoch wird das Selbst zu einem Phänomen, welches allein als Entität zu bezeichnen und demnach nicht falsifizierbar ist: „Beziehen sich unser Selbstgefühl und unsere Intuition von Handlungsurheberschaft und Willensfreiheit auf etwas Wirkliches – oder sollten wir sie als nette Illusion betrachten, die ein Produkt eitler Selbsttäuschung sind?“
Wolfgang Prinz umgeht diese Polarität, indem er die als illusionär bezeichneten Vorstellungen eines angetäuschten Selbst strikt von der ‚wirklichen‘ und also faktischen Wirklichkeit abkoppelt und der sozialen Kategorie zuschreibt, wobei beide Sphären für das Individuum letzten Endes keinen Unterschied ausmachen: „Dieser Perspektive zufolge erscheint Willensfreiheit als eine gesellschaftliche Institution – eine soziale Tatsache, und nicht als Naturtatsache. Doch […] sind soziale Tatsachen nicht weniger wirklich und wirksam als Naturtatsachen. Ich werde daher zu dem Schluß gelangen, daß Willensfreiheit keine Illusion, sondern etwas Wirkliches ist: Diejenigen, die sie sich angeeignet haben, besitzen sie tatsächlich.“ So einfach kann das manchmal sein, ist es aber in Wahrheit natürlich nicht, vermischt Prinz hier doch grundverschiedene Kategorien und umgeht damit nur eine Problematik, ohne sie wirklich ins Visier genommen zu haben.
Dass diese Kernthesen erst nach der ersten Hälfte des Buches formuliert werden, liegt an den einführenden Bemerkungen, die bei weitem zu viel Raum einnehmen und das eigentliche Thema beständig aus den Augen verlieren: Erst nach hundert Seiten etabliert Prinz eine kurze Theorie des Spiegels als Grundform sozial intendierter Selbstwahrnehmung und Selbstkonstitution: Das Selbst wird dann später und abermals viel zu spät als „selbstreferentielle Repräsentation des repräsentierenden Systems“ definiert, das sich ausgehend von der kontextuellen Setzung erst etabliere – das Selbst entsteht demnach erst durch die verdoppelte Spiegelung im Umgang mit dem oder den Anderen. Hieraus entwirft Prinz nun eine Theorie der Kollektivität, die aber rudimentär bleibt und beispielsweise die vor einiger Zeit wiederentdeckten Ausführungen Gabriel Tardes in den „Gesetzen der Nachahmung“ aus dem Jahre 1890 aufnimmt, ihnen aber insgesamt wenig hinzuzusetzen hat.
So regelrecht originell und genial wie Prinz diese seine Theorie bereits im Vorwort bezeichnet, scheint mir dies alles daher nun doch nicht zu sein: Im Ansatz fühlt man sich an Tarde oder die memetische Theorie Richard Dawkins und Susan Blackmores und vor allem an Sartres Blick-Metapher erinnert, die allesamt die hier verhandelten Thesen ebenfalls und meines Erachtens origineller behandeln, doch wird dies mit keinem Wort erwähnt. Zudem ist die grundlegende Spiegeltheorie bei weitem zu schematisch definiert – oder eben falsch. So heißt es einmal: „Spiegel sind bemerkenswerte Instrumente. […] Beispielsweise können Spiegel uns dabei helfen, um Ecken zu schauen oder das zu sehen, was hinter unserem Rücken geschieht. Vor allem ermöglichen sie es aber, daß wir unser eigenes Gesicht und unseren eigenen Körper auf genau dieselbe Weise sehen können, wie wir die anderen ständig sehen und wie folglich auch diese uns ständig sehen.“
Mit Verlaub, ein derart neutraler Standpunkt lässt sich durch den Spiegel kaum etablieren, da man im Spiegel sich selbst eben nicht so wie andere im Sinne der Außenperspektive erkennt, sondern gezwungen ist, ständig in den Spiegel zu schauen und also in seiner Außensicht auf sich selbst nur einen Ausschnitt der Realität gewinnt – einen Ausschnitt, der bei weitem nicht ausreicht, den Blick des Anderen zu imitieren: Jeder, der von sich selbst einmal Filmaufnahmen gesehen hat, die ohne eigenes Wissen vorgenommen wurden, weiß um diese Diskrepanz zwischen tatsächlicher und gespiegelter Selbstansicht. Besieht man sich auf diese Weise, erkennt man sich in der Tat neu und gewinnt eine Distanz zu sich, die mit dem Spiegelbild nicht zu vergleichen ist – so und nicht anders sehen die Anderen einen aber.
Dass diese Spiegelmetapher im vorliegenden Werk nicht grundsätzlicher, ausführlicher und vor allem moderner problematisiert wird, schadet letztlich der Theorie, die insgesamt, wie erwähnt, ohnehin wenig Originelles zu bieten hat und vielleicht in den 1950er-Jahren interessant gewesen wäre, heutzutage aber, wo Ideen wie Schwarmintelligenzen das Selbst sowieso mehr und mehr anzweifeln, einfach nur obsolet ist und leider aufgrund der sehr speziellen Sichtweisen des Autors auch nicht zur Einführungslektüre in ein höchst interessantes Problem taugt.
|
||