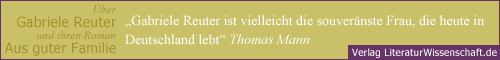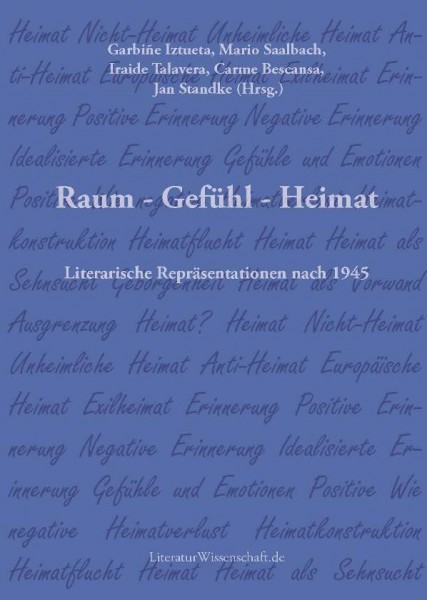Mit Pionieren in die Zukunft?
Ein Sammelband unternimmt eine vorausschauende Bestandsaufnahme der literarischen Ökonomik
Von Manuel Bauer
Kaum ein anderes Gebiet hat das Denken der Kulturwissenschaften in den letzten Jahren so stark beschäftigt wie der geradezu allumfassende Diskurszusammenhang der Ökonomie. Davon zeugt der von Iuditha Balint und Sebastian Zilles herausgegebene Sammelband „Literarische Ökonomik“, der die weit verzweigten Forschungen zum schwer begrenzbaren Bereich „Literatur und Ökonomie“ bündeln möchte. Das Buch präsentiert Texte von, wie es mit einigem Recht heißt, „Pionieren des Forschungsfeldes“ – von Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Disziplinen, die in den letzten Jahren durch innovative und wichtige Arbeiten maßgeblich zur Relevanz des Gegenstandes beigetragen haben. Die Versammlung solcher Kapazitäten und der prägnante Titel zeigen an, dass nicht einfach eine weitere Publikation zum Thema erwartet werden soll, sondern eine gleichermaßen rückblickende wie zukunftsweisende Inventur, die von den Branchengrößen selbst durchgeführt wird. Ein solches Ansinnen schürt Erwartungen und wirft interessante Fragen auf. Ist ein vorläufiger Höhepunkt, ein Abschluss gar erreicht? Soll zu neuen Ufern aufgebrochen werden? Wird eine vermeintliche Modeerscheinung zu einem historischen Gegenstand? Werden feste Grenzen gezogen und verbindliche Definitionen erarbeitet?
Kurios ist der letzte Satz des letzten Beitrags: „An dieser Stelle wäre eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse sinnvoll.“ Die geforderte Zusammenfassung wird dem Leser indes vorenthalten. Der editorische Lapsus geht mit einer konzeptionellen Frage einher: Ist es möglich, die Ergebnisse nicht nur der je einzelnen Aufsätze, sondern des gesamten Unternehmens, gar der gesamten Forschungsdiskussion zusammenzufassen? Die erste von zwei Einleitungen mit dem Titel „Was ist literarische Ökonomik?“ scheint eine solche Zusammenfassung mittels der, so der Untertitel, „Wesensbestimmung und Entwicklung einer Methode“ vorzulegen. Iuditha Balint führt aus, die Literaturwissenschaft befasse sich erst seit den 1970er-Jahren mit ökonomischen Aspekten literarischer Werke, wobei als Geburtsstunde der literarischen Ökonomik im engeren Sinne Jochen Hörischs Buch „Kopf oder Zahl“ von 1996 ausgemacht wird. Balint unterscheidet bei den literaturwissenschaftlichen Zugängen zu ökonomischen Zusammenhängen zwischen der Wahrnehmung der Wirtschaft durch die Literatur und der Übertragung des Begriffs der Ökonomie auf diverse andere Bereiche. Im ersten Fall richte sich die Konzentration auf die literarische Darstellung der Ökonomie als gesellschaftlicher Sphäre, im zweiten werde Ökonomie zur Metapher, die gleichwohl die Frage nach der „Ökonomisierung von Denkbereichen“ aufwerfe. Weitere Perspektiven seien die Beschäftigung mit literarischen Werken als Quelle zur Korrektur ökonomischen Wissens, die rhetorische Analyse ökonomischer Texte sowie Analysen wirtschaftswissenschaftlicher Theorien und ökonomischer Phänomene mit einem literaturwissenschaftlichen Instrumentarium, etwa wenn die allfällige Rede vom „Fiktionalen“ der Finanzökonomie mit avancierten Theorien der Fiktionalität beleuchtet wird.
Eine Definition sei schwierig, da es schlechterdings „keine homogene literaturwissenschaftliche Theorie oder Methode“ gebe, die sich als „literarische Ökonomik“ bezeichne. Das wäre dann doch recht wenig Ertrag für einen Text, der mit dem Anspruch der „Wesensbestimmung einer Methode“ antritt. Daher schlägt Balint vor, „literarische Ökonomik“ als Methode zu begreifen, die verschiedene Dimensionen umfasst – nämlich just die, die zuvor schon als die bislang in der Forschung zu verzeichnenden Perspektiven benannt wurden. Ob zur gewünschten „Abgrenzung“ taugt, was zuvor als heterogen beschrieben wurde, stehe dahin. Ohnehin ist zu fragen, weshalb überhaupt von einer „Methode“ die Rede ist. Bei der literatur- und kulturwissenschaftlichen Beschäftigung mit ökonomischen Sachverhalten im weitesten Sinne sind schließlich diverse methodische Zugänge denkbar. Problematisch ist an dieser vermeintlichen Methodenbezeichnung zudem, dass in den einzelnen Beiträgen ohne Erklärung oder Abgrenzung bald von „literarischer Ökonomie“, bald von „literarischer Ökonomik“ die Rede ist. Eine einheitliche Verwendung oder doch zumindest ein erklärender Hinweis auf den Grund der Abweichung wäre bei der Etablierung eines Begriffs sicher nicht von Nachteil.
Wie Sebastian Zilles in der zweiten Einleitung erklärt, stehe der Band nicht nur für eine Bestandsaufnahme der bisherigen Leistungen, sondern auch für eine „Neuausrichtung der Beschäftigung mit dem ökonomischen Wissen der Literatur“. Insbesondere werde das durch die Beiträge von Christine Künzel und Birger P. Priddat geleistet. Künzel versucht sich am Nachweis, dass Literaturwissenschaft zur Erklärung ökonomischer Probleme nützlich sein kann. Sie untersucht, wie bereits angedeutet, im Rückgriff auf literaturtheoretische Ansätze das „Fiktionale“ der Finanzökonomie. Priddat wiederum hebt aus Sicht eines Wirtschaftswissenschaftlers den Nutzen literarischer Texte für die ökonomische Theoriebildung hervor. Literatur liefere alternatives Wissen, da sie Aspekte veranschauliche, die in der rationalistischen Ökonomik unbehandelt blieben.
Die übrigen Beiträge schlagen einen denkbar weiten historischen und kulturtheoretischen Bogen. Christina von Braun diskutiert Geld als Schrift- beziehungsweise Zeichensystem und dadurch auch eine Nähe von Geld und Literatur. Uwe C. Steiner geht von der Hausväterliteratur des 16. und 17. Jahrhunderts und damit einer älteren Form der Ökonomik aus, die er im Anschluss an Michel Foucault als gouvernementale Praxis liest; in diesem Zusammenhang diskutiert er unter anderem Texte von Hans Sachs und Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen. Der Übergang von den Wissensordnungen des Kameralismus zur Nationalökonomie um 1800 ist Thema von Joseph Vogls Aufsatz zur „Romantischen Ökonomie“, bevor Hans Christoph Binswanger „Wilhelm Meisters Wanderjahre“ von Johann Wolfgang Goethe als Wirtschaftsroman vorstellt, der auf zahlreiche realökonomische Wandlungen seiner Zeit reagiert. Ebenfalls um Goethe-Texte kreisen Jochen Hörischs Überlegungen zu den Affinitäten von Geld und Wein, während Bernd Blaschke sich mit der „kapitalismusaffinen Begehrens-Anthropologie“ in Romanen Emile Zolas auseinandersetzt. Franziska Schößler widmet sich der geschlechtsspezifischen Bewertung verschiedener Facetten der „Arbeit“ von Sekretärinnen in mittlerweile zumeist vergessenen literarischen Texten der Zwischenkriegszeit.
Die unterschiedlichen Gegenstände und verschiedenen Zugangsweisen zeigen die Vitalität dieser nur lose verbundenen Forschungsrichtung, die auch wegen ihrer Heterogenität so fruchtbar und anregend wirken konnte. Die Schwierigkeit einer umfassenden begrifflichen Bezeichnung liegt auf der Hand – muss aber schlichtweg ausgehalten werden, wenn die Breite der Sujets und der Erkenntnisinteressen nicht eingegrenzt werden soll. Ob sich der Terminus der „literarischen Ökonomik“ durchsetzt, bleibt abzuwarten. An der Zeit für eine Zwischenbilanz ist es allemal. Das einstweilige Ausbleiben einer Zusammenfassung der Ergebnisse zeigt an, dass das Projekt offen und supplementierbar ist – und längst nicht abgewirtschaftet hat.
|
||