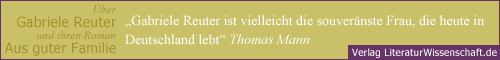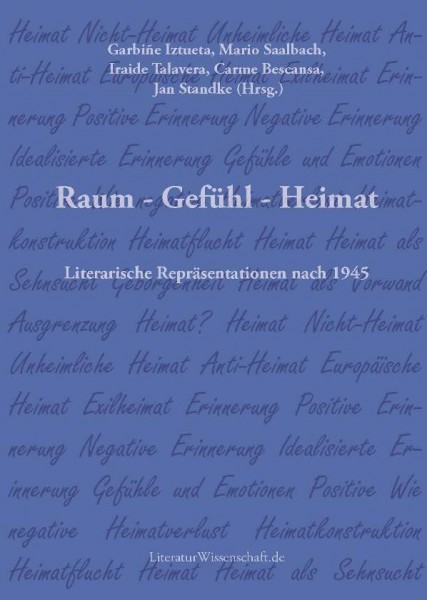„Poesie ist das schlechte Gewissen der Literatur“
Durs Grünbeins Frankfurter Poetikvorlesung
Von Daniele Vecchiato
Nach Durs Grünbein sei die Zeit der literarischen Manifeste vorbei. Die Literatur sei nur noch durch den Rhythmus des Buchmarkts skandiert, für das Diktat des Dichters – oder der Dichtergruppen – gebe es keinen Platz mehr. Die Poetik als Maßstab setzende Norm einer Strömung, als dogmatisches „Flugblatt oder Strategiepapier“ existiere nicht mehr – dafür aber kann jeder Dichter für sich selbst sprechen und die eigene Poetik als persönlicher Orientierungsversuch im Reich der Sprache schätzen.
In der Vorlesung „Vom Stellenwert der Worte“, die Grünbein Ende 2009 zum 50. Jubiläum der berühmten Frankfurter Poetikdozentur gehalten hat, skizziert der Dresdner Schriftsteller die Grundzüge seiner „Psychopoetik“. All die Ingredienzien seiner Produktion werden erwähnt, von der bitteren Darstellung der eigenen DDR-Erfahrung zum elegischen Gesang der zerstörten und wiederaufgebauten Stadt Dresden, vom Primat des Körpers als Einspruch gegen die Utopien bis zur Entdeckung der Antike als „Archäologie der […] überdauernden Motive“, von der Auffassung der Poesie als Trancezustand zum Sarkasmus als Gegengift gegen die Verstellungen der Rhetorik und der Metaphysik.
Gerne listet der omnivore Leser und poeta doctus die Prosaautoren und die Lyriker auf, die zu seiner autodidaktischen Bildung beigetragen haben. Und er lässt die wichtigsten Etappen seiner biografischen und literarischen Entwicklung mit Rührung und Erkenntlichkeit vorüberziehen, von den auratischen Anfängen seiner Schriftstellerei zum durch Heiner Müller vermittelten Kontakt zum Suhrkamp Verlag, bis hin zur internationalen Akklamation zum bedeutendsten Dichter des wiedervereinigten Deutschlands.
Mit diesem Bändchen macht Grünbein – nach dem lesenswerten „Die Bars von Atlantis“ – einen weiteren Schritt im Sinne einer akkuraten Systematisierung des eigenen Werkes einerseits und einer selbstgefälligen Konstruktion des eigenen image andererseits: Die Poetikvorlesung liest sich wie eine Bilanz der Erfahrung Durs Grünbeins als Dichter eher als eine Rede über die Dichtkunst. Und das absichtlich.
Nicht als einen präskriptiven Dekalog sondern als eine deskriptive Reflexion über den eigenen modus poetandi müssen also die zehn Punkte gedeutet werden, die die Vorlesung abschließen. Es geht dabei um die bescheidene „Theorie vom Ortssinn der Worte“, von der genauen Stellung des Wortes innerhalb einer Zeile, eines Gedichtes, eines ganzen Opus: „Alles kommt darauf an, das Wort an der richtigen Stelle im Vers anklingen zu lassen, nicht zu früh, nicht zu spät“.
Im postavantgardistischen und postutopischen Zeitalter sei Poesie „Subjektmagie als Sprachereignis“, Dichtung stelle laut Grünbein „eine Periphrase des Menschenlebens“ dar, jeder Vers sei mit Physis und Psyche seines Verfassers unentwirrbar verbunden. Die Worte gewinnen „[i]hre wahre Bedeutung […] erst im Licht der Erfahrung“, jedes Wort „bekommt im Leben in einem bestimmten Moment erst seinen durchschlagenden Sinn und wird erst dann gleichsam scharfgestellt“.
Lyrik wird als das Genre des extrem Subjektiven gepriesen, als das „Absolutum der Sprache“. Das Gedicht, sagt uns Grünbein am Ende, ist alles, was bleibt – jenseits des Rampenlichtes der literarischen Szene, jenseits aller ökonomischen Interessen der Verleger, jenseits der verstaubten Pedanterie alter Akademiker und der Kritik der Rezensenten.
|
||