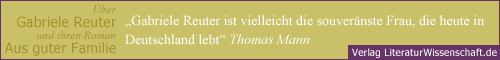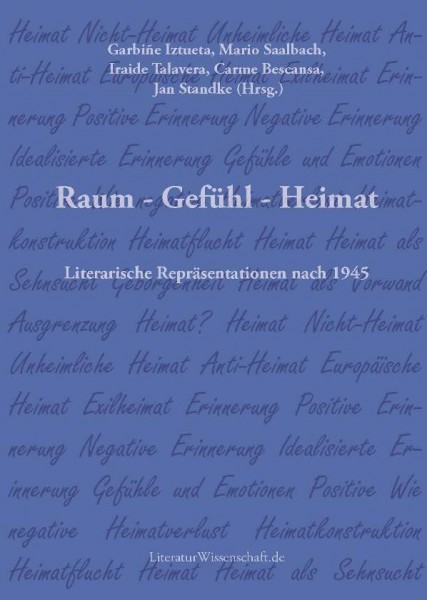Von der Posse zum Staatsakt
Peter Hacks verweigert modische Zugeständnisse
Von Kai Köhler
"Die späten Stücke" Peter Hacks' kündigt der Titel der beiden hier zu rezensierenden Bände an. Das klingt nach Werkausgabe, und zwar für einen Klassiker, dessen gesamtes Schaffen heute überschaut werden könne. Doch der 1928 geborene Hacks lebt noch, und nichts deutet darauf hin, dass er künftig zu schweigen beabsichtigt. So verweist der Sammelbegriff möglicherweise auf eine andere Bedeutung: Darauf, dass es sich um Dramen einer Spätzeit handeln könnte, für eine Gesellschaft ohne Zukunft.
In der gesichert erscheinenden DDR der 60-er und 70-er Jahre hatte Hacks seine postrevolutionäre Dramaturgie entwickelt: Auf der Basis dessen, was er für erreicht hielt, sollte Kunst zum poetischen Vorschein künftiger Versöhnung werden. Während etwa Volker Braun die Widersprüche auch der sozialistischen Gesellschaft pointierte, während Heiner Müller mittels antiker Stoffe die Gewaltsamkeit des Bestehenden zeigte, verlor scheinbar der klassizistische Hacks den Bezug zur Gegenwart. Dennoch blieben selbst seine oberflächlich betrachtet harmonisierenden Komödien wie "Ampitryon" oder "Omphale" nicht ohne engen Bezug auf das, was auch aus Hacks' Sicht in der DDR noch nicht erreicht war.
Diese Poetologie verliert zumindest eine ihrer Voraussetzungen, wenn das "noch nicht" zum "nicht mehr" wird. Natürlich bleibt die Hoffnung auf eine ferne Zukunft: "Gut, das Jahrtausend war nichts. Sprechen wir / Von Nummer drei, Genossen, oder vier", dichtet Hacks unter dem Titel "Abschied vom zweiten Jahrtausend". Das aber beantwortet nicht die Frage, wie ein Theaterkonzept, das für eine sozialistische Klassik entstand, in nachsozialistischer Zeit bestehen könne.
Die "späten Stücke" weisen eine beeindruckende Vielfalt von Genres und Stoffen auf. Den ersten Band eröffnet ein Lustspiel: "Fafner, die Bisam-Maus". In einer verwickelten Erbstreitigkeit droht dem Maskenbildner Lorch der Verlust des von ihm seit langem bewohnten Hauses. Glücklicherweise sind die Kostüme für eine Aufführung von Wagners "Siegfried" zur Hand. So setzen Lorch und sein Geliebter Kasprik unterschiedliche Verkleidungen ein - die natürlich aus Sicht des Zuschauers allesamt grotesk jede Glaubwürdigkeit verfehlen. Sie überzeugen dagegen den Eindringling Wesselbrunner davon, dass eine auch durch stärkstes Gift nicht zu vertilgende Riesenbisam-Maus Gebäude und Grundstück bereits untergraben habe und nächstens eine Überflutung auslösen werde, die den Eigentümer als den Schuldigen unwiderruflich ruiniere. Wesselbrunner verzichtet, erhebt aber seine Ansprüche erneut, als ihm das Spiel aufgelöst wird. Ein rettendes Testament des Urahnen vernichtet jedoch im vorletzten Moment die juristische Grundlage seines Anspruchs, und im letzten Moment erfährt er, dass mittlerweile er selbst Vermögen und Haus verloren hat. Mit seiner Familie findet er Aufnahme im Haus seines Verwandten, und ein utopisches Zusammenleben zeichnet sich ab.
Es liegt nahe, die Posse als komödiantische Deutung der Übernahme der DDR durch den Westen zu lesen. Grundsituation wie manche Details deuten darauf hin - vieles aber fügt sich einem solchen Schema nicht. Ebenso wie die anderen Dramen ist "Fafner" kein Schlüsselstück. Das Theater als Spiel kann nur dann als ästhetische Befreiung fungieren, wenn ein grob Stoffliches als Bindekraft vorhanden ist und gleichzeitig sich allzu enge Bedeutung verflüchtigt. Dem entspricht das theatralische Spiel im Spiel, das für die Figuren der Handlung leicht durchschaubar wäre und dennoch zum Erfolg führt; Theater als Bestandteil der Handlung oder zumindest des Dialogs findet sich in fast jedem der zehn "späten Stücke".
Gleiches gilt für den utopischen Schluß. Alle Dramen finden ein gutes oder doch wenigstens versöhnliches Ende. Natürlich wissen auch Hacks wie sein Publikum, dass westliche Alteigentümer auf sprechende Bisam-Mäuse in Wagnerschem Drachenkostüm nicht hereinfallen, dass rettende Testamente ebenso rar sind wie es die Pleite des Feindes ist, jedenfalls bevor dieser ernsthaft Schaden anrichten konnte. Deshalb verklärt der Schluss nicht versöhnlerisch Realität, sondern setzt einen heiteren Kontrapunkt. Die Gewalt, die eine gelungene Vertreibung bedeutet hätte, bleibt indessen im Bewusstsein. Sie mag dadurch wirksamer angegriffen sein als durch die krude Körperlichkeit, die sich auf manchen Bühnen heute als kritisch ausgibt und doch meist nur Sensationsgier befriedigt.
Die anderen Stücke sind zum Teil resignativer. In der Aristophanes-Bearbeitung "Der Geldgott" versprechen sich arme Leute Gewinn dadurch, dass sie den heruntergekommenen Pluto wieder zu altem Glanz verhelfen. Natürlich lohnt dieser es ihnen nicht; und nur knapp kann sich das Glück gegen die erneute Herrschaft der Reichen behaupten. "Der Maler des Königs", Boucher, ist verarmt und aus der Mode gekommen; seine erotischen Bilder verfallen dem moralischen Verdikt der nun erfolgreicheren Künstler, die die aufkommenden bürgerlichen Tugenden propagieren. Am Ende des Stückes triumphiert Boucher: Sein meistgehasster Konkurrent scheitert am Hof. Doch weiß der Zuschauer, dass die aristokratische Kunst Bouchers auf lange Sicht ohne Perspektive sein wird.
Dennoch ist Hacks' Theater heiter, auch durch seine Sprache. Von moderner Sprachkrise scheint dieser Autor wenig zu wissen. Er zielt auf die gelungene Formulierung, wenn es sein muß, auch abseits der Handlung. Seine Figuren konstituieren sich sogar dort, wo sie resignieren, als Subjekte auch, indem sie Welt in und durch Sprache fassen. Dass dem real nur bedingt so ist, leugnet Hacks nicht; im Gegenteil finden sich in fast allen Stücken abfällige Äußerungen über das Volk, das nicht begreift. Auch in dieser Hinsicht ist seine Kunst Gegenbild.
Im Gegensatz zur klassischen Dramensprache zielt Hacks jedoch auf Entpathetisierung. Sowohl in Vers als auch in Prosa - mit diesem Unterschied arbeitet Hacks sehr bewusst - dominiert ein Konversationston, der zeigt, daß die Situationen einer vernünftigen Betrachtung zugänglich sind. So hat in "Genovefa" der Pfalzgraf Siegfried, anders als in früheren Versionen des Stoffes, den Vorwurf der Untreue, der seine Frau traf, früh durchschaut. Auch bei Hacks trifft er die Verbannte im Wald; jedoch die dramatische Wiedererkennung bleibt aus. An ihrer Stelle folgt ein weiterer Akt, der sieben Jahre später spielt. Im Wirtshaus "Zur heiligen Genovefa" plaudert er mit seinem Sohn über die Vergangenheit und stellt fest: "Ich sage dir was, eine Änderung, deren Herbeiführung einer Entscheidung bedarf, war nicht zum Guten. Es ist die Zeit, die die Dinge ändert, nicht der Mensch."
Mit dieser Szene schließt der erste Band. Vielleicht ist Hacks, jedenfalls ist Siegfried hier weit entfernt vom eingangs zitierten Appell an die Genossen, die ja aus dieser Perspektive überflüssig sind. Eher erinnert dieses Ende an das auf den Einzelnen bezogene Couplet "Guter Ton" aus der gleichen Gruppe: "Geh unter, Mensch, doch werd nicht wunderlich / Im Untergang. Die Zukunft sieht auf dich."
Der zweite Band akzentuiert das Formbewußtsein, zu dem diese Verse aufrufen, zuerst durch zwei neue Versionen des Orpheus-Mythos. Die drei historischen Schauspiele, die die Sammlung abschließen, stellen dann ästhetisch die größte Provokation dar: durch ihren scheinbaren Konservativismus. "Bojarenschlacht", "Tartarenschlacht" und "Der falsche Zar" greifen drei Episoden aus der russischen Geschichte auf, um das Problem der klugen Herrschaft zu erwägen. Drei Mal fünf Akte mit klassischem Aufbau, in denen jeweils die Einheit von Ort und Zeit gewahrt ist; mit dem vorbildlichen Reichsgründer Rurik und dem lernbereiten Dmitri zwei selbstmächtige Fürsten, zuletzt der überlegene Verschwörer Schuiski, der den vom westlichen Ausland gesteuerten Zaren ersetzt.
Zwei Königsdramen wurden in den letzten Jahren breit diskutiert: Handke nimmt in den "Zurüstungen für die Unsterblichkeit" seine Setzungen in milder Melancholie zurück und entzieht sich so der Diskussion des Politischen. Botho Strauß propagiert in "Ithaka" die Rückkehr zum Mythos und landet doch nur bei neokonservativen Platitüden. Hacks dagegen entpathetisiert auch im Geschichtsstück. Selbst die Reichsgründung wird im leichten Ton bewältigt. Staatskunst erscheint als Angelegenheit der Vernunft, die freilich nur möglich ist, wo erst einmal Staat ist; die Diffusion von Macht in eine Zivilgesellschaft dürfte Hacks' Sache nicht sein. Das Vergnügen, das die Klarheit dieser Dramen bereitet, mag die Frage vergessen lassen, wie denn überhaupt die Planbarkeit von Politik zurückzugewinnen ist. Sie zu beantworten, ist jedoch nicht Sache des Dichters, der durch die ästhetische Vorwegnahme Genuss herstellt und das Publikum auf die Aufgabe verweist, seine "späten Stücke" zu historisch frühen Stücken werden zu lassen.
|
||||